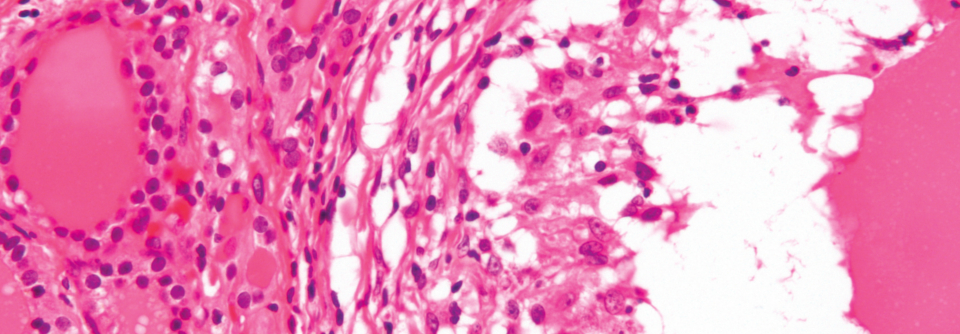Postpartale Depression: „Am liebsten würde ich das Kind zurückgeben“
 Es ist wichtig eine kurzweilige Depression von einer Psychose zu unterscheiden.
© iStock.com/SolStock
Es ist wichtig eine kurzweilige Depression von einer Psychose zu unterscheiden.
© iStock.com/SolStock
Fünf Wochen, nachdem ihr Sohn geboren wurde, kamen der 28-Jährigen zum ersten Mal die Gedanken, ihm etwas anzutun. Immer wenn sie ihn badet, sieht sie ihn plötzlich unter Wasser. Wenn sie am Fenster steht, sieht sie ihn hinunterfallen. Diesen Gefühlen gewahr, packt die Frau alle Messer weg und badet das Kind nur noch in Anwesenheit ihres Mannes. Erst als sie auf Drängen ihrer Hebamme zu einem Spezialisten geht, spricht sie das erste Mal darüber.
Ähnlich wie dieser jungen Mutter ergeht es vielen Frauen nach der Geburt ihres Kindes. Etwa die Hälfte aller Mütter in Deutschland leidet direkt nach der Entbindung unter einem „Babyblues“. Die leichte depressive Verstimmung klingt jedoch in der Regel innerhalb von 14 Tagen ab. Anders gestaltet es sich bei einer schwereren postpartalen psychischen Störung, schreiben die Privatdozentin Dr. Anke Brockhaus-Dumke, Rheinhessen-Fachklinik Alzey, und Dr. Valenka Dorsch, Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach in Weißenthurm.
Mit 10–15 % ist die postpartale Depression (PPD) das häufigste Störungsbild nach der Geburt. Sie beginnt meist schleichend, dauert unbehandelt durchschnittlich sieben Monate und kann zu einer Bindungsstörung zwischen Mutter und Kind führen. Neben hormonellen Veränderungen scheinen insbesondere spezifische Belastungen sowie Anforderungen an die neue Lebenssituation ursächlich eine Rolle zu spielen.
Zwangsgedanken, dem Kind etwas anzutun
Neben den allgemeinen Symptomen einer Depression leiden die betroffenen Frauen vor allem an Ängsten, Sorgen und Schuldgefühlen gegenüber dem Kind. Eine Besonderheit der postpartalen Depression sind die Zwangsgedanken, dem eigenen Kind etwas anzutun, wie sie die 28-Jährige im Fallbeispiel schilderte. Solche Gedanken werden von 20–40 % der Frauen berichtet und als besonders belastend empfunden.
Eine PPD zu erkennen ist allerdings nicht immer einfach, da sich ihre Symptome häufig kaum von physiologischen Anpassungsvorgängen aus Schlafproblemen, Erschöpfung und Stimmungsschwankungen unterscheiden, die jede Mutter nach der Geburt durchlebt, schreiben die Autorinnen. Differenzialdiagnostisch ist die Depression von einer postpartalen Angst- und Zwangsstörung, einer posttraumatischen Belastungsstörung nach Entbindung sowie einer postpartalen Psychose (s. Kasten) abzugrenzen. Erste Hinweise auf eine PPD liefern Selbstbefragungsbogen wie beispielsweise die Edinburgh Postnatal Depression Scale.
Psychose erfordert stationäre Behandlung
Psychopharmaka bei Stillenden sorgfältig abwägen
Je nach Schwere der Erkrankung erfolgt die Therapie ambulant, in einer Tagesklinik oder stationär. Letzteres ist vor allem bei schweren Depressionen, Zwangs- oder psychotischen Störungen indiziert, erklären die Autorinnen. Einen wichtigen Teil der Behandlung nimmt die soziale Unterstützung der Mutter und anderer Familienmitglieder ein. Diese kann z.B. aus einer verlängerte Hebammenbetreuung, einer Haushaltshilfe durch die Krankenkasse, die Einbindung des Partners (Elternzeit) oder Selbsthilfegruppen bestehen. Falls Psychopharmaka erforderlich werden, müssen bei stillenden Müttern vorab sorgfältig Risiken und Nutzen gegeneinander abgewogen werden. Hilfreiche Informationen dazu gibt das Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie in Berlin (www.embryotox.de).Quelle: Brockhaus-Dumke A, Dorsch V. InFo Neurologie & Psychiatrie 2019; 21: 32-39