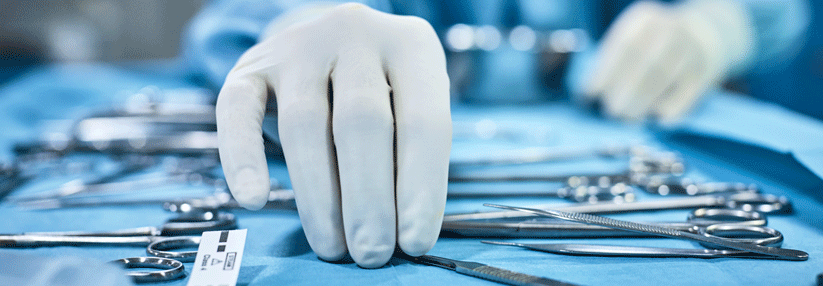
Massenhaft unnötige Diagnostik Präoperativ noch schnell auf Nummer sicher gehen – oder besser nicht?
 Der Grund, warum so viele Tests angeordnet werden, liegt auch im komplexen Zusammenspiel der unterschiedlichen Fachdisziplinen und der damit einhergehenden mangelhaften Kommunikation.
© fotoquique /gettyimages
Der Grund, warum so viele Tests angeordnet werden, liegt auch im komplexen Zusammenspiel der unterschiedlichen Fachdisziplinen und der damit einhergehenden mangelhaften Kommunikation.
© fotoquique /gettyimages
Das Ausmass der Untersuchungen vor einer OP sollte sich nach dem individuellen Risiko des OP-Kandidaten und den Gefahren der geplanten Intervention richten. Asymptomatische Patienten benötigen vor Eingriffen mit niedrigem Risiko in der Regel keine Routinetests. Das britische Institut für Qualität im Gesundheitswesen (NICE) und die internationale Klug-Entscheiden-Initiative sprechen sich ausdrücklich gegen die generelle Durchführung von Laboruntersuchungen, EKG, kardialen Stresstests vor leichten Operationen (z.B. Hautexzisionen, Augen- und Dentalchirurgie, Brustbiopsie) aus.
Gleiches gilt bei einer mittleren Gefährdung (Leistenhernien-OP, Kniearthroskopie, laparoskopische Cholezystektomie etc.). Der Verzicht auf unnötige Routinetests (s. Tabelle) bietet eine gute Gelegenheit zur Qualitätsverbesserung in der Chirurgie, schreiben Dr. Lesly Dosset von der University of Michigan in Ann Arbor und Kollegen.
Die Realität sieht allerdings noch anders aus. In einer US-amerikanischen Studie zu nichtkardialen Operationen bei über 65-Jährigen (Brustchirurgie, Hernienreparatur etc.) erhielten 45 % eine unnötige kardiale Diagnostik, z.B. Stresstest, EKG, kardiale Bildgebung.
| Die optimale präoperative Diagnostik | |||
|---|---|---|---|
|
| Patient mit | Patient mit | |
| leichtes bis mittelschweres OP-Risiko | kein Routinetest | komorbiditätsspezifischer Test (z.B. HbA1c) | |
| hohes OP-Risiko | OP-spezifischer Test (z.B. Blutbild bei erwartetem Blutverlust) | Entscheidung von | |
Zusatzdiagnostik kann die Intervention verzögern
Auch in einer kanadischen Arbeit zu leichten Eingriffen (Endoskopie, Ophthalmochirurgie) wurde bei mehr als 30 % ein EKG abgeleitet. Diverse Studien haben aber ergeben, dass Blutbild, Nierenfunktion, Gerinnung, EKG etc. vor leichten bis mittelschweren Operationen für die Patienten keine Vorteile bringen. Die Ergebnisse führen weder zu einer Modifikation der geplanten Therapie noch zu einer Reduktion unerwünschter Ereignisse. In einer wissenschaftlichen Erhebung veränderten die Routinetests nur in weniger als 2 % der Fälle das Management und auch dann wurde kein klinischer Nutzen festgestellt.
Ausserdem können die überflüssigen Analysen dem Patienten schaden, beispielsweise indem sie eine nicht benötigte fachärztliche Abklärung veranlassen. In einer Studie bei älteren Patienten ohne bekannte kardiale Erkrankung unterzogen sich 25 % mindestens vier weiteren Massnahmen (Untersuchungen, Therapien, stationäre Aufenthalte etc.).
Eine weitere Gefahr ist, dass die multiple Zusatzdiagnostik die chirurgische Intervention verzögert. In einer Studie zur Kataraktchirurgie mussten 35 % der OP-Kandidaten mehr als einen Monat auf den Eingriff warten, 8 % sogar mehr als 90 Tage. Was die Finanzen betrifft, schätzen die Autoren, dass in den USA die unnötigen präoperativen Tests jedes Jahr Kosten von etwa 18 Milliarden Dollar verursachen. Hinzu kommen Arbeitsausfälle, Zusatzkosten für Patienten (Anreise, Zuzahlungen) und die generelle Ressourcenverschwendung.
Falsche Annahmen und Killerphrasen
Einer positiven Veränderung steht vor allem das komplexe Zusammenspiel der verschiedenen Fachdisziplinen im Weg. Chirurgen bestellen die Tests oft, weil sie glauben, der Anästhesist wolle sie haben. Die Narkoseärzte trauen sich umgekehrt nicht, von Operateuren angeordnete Untersuchungen zu streichen. Auch die relativ niedrigen Kosten für einzelne Massnahmen spielen eine Rolle. Zudem ist das ärztliche Beharrungsvermögen – «Wir haben es schon immer so gemacht!» – nicht zu vernachlässigen. Zu guter Letzt denken viele Kollegen, die seltenen Risiken des Unterlassens überwiegen potenziell schädliche Konsequenzen des Durchführens. Dahinter steht nach Meinung der Autoren die Annahme, eine Screeninguntersuchung könne nie schaden.
Quelle: Dossett LA et al. BMJ 2022; 379: e070118; DOI: 10.1136/bmj-2022-070118.





