
Hautkrebsscreening Pro und Kontra – und ein Pilotprojekt, KI mit einzuspannen
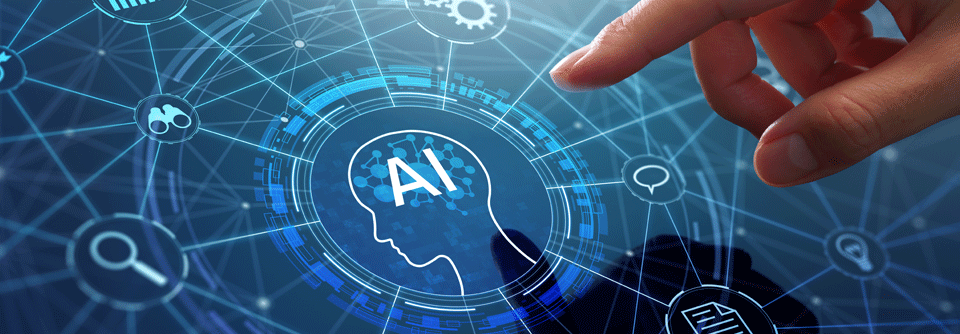 Soll das Hautkrebsscreening enden? Fachleute diskutierten Pro und Contra sowie technische Lösungsansätze parallel.
© tadamichi – stock.adobe.com
Soll das Hautkrebsscreening enden? Fachleute diskutierten Pro und Contra sowie technische Lösungsansätze parallel.
© tadamichi – stock.adobe.com
Wir verschwenden unsere Zeit damit, komplett gesunde Menschen zu untersuchen“, lautete das Hauptargument von Prof. Dr. Susana Puig von der Universitätsklinik Barcelona gegen ein Screening auf Hautkrebs.1 Wenn man die Zahlen zu Inzidenz und Mortalität zwischen verschiedenen europäischen Staaten vergleiche, komme es möglicherweise eher auf den Zugang zu dermatologischen Angeboten an.
Einer deutschen Studie aus 2023 zufolge sei der populationsweite Effekt des Hautkrebsscreenings auf die Melanommortalität minimal und nicht signifikant. Dass das Screening zu Überdiagnosen bzw. einer hohen Zahl an Melanoma-in-situ-Diagnosen führen kann, betrachtete die Referentin dabei weniger als Problem. „Damit identifizieren wir immerhin eine Risikogruppe“, so ihre Begründung. Aber solche Läsionen müssten nicht immer entfernt werden.
In einer deutschen Publikation aus 2018 konnte das Verhältnis von Aufwand und Resultat von 606 auf 178 untersuchte Personen pro detektiertem Melanom gesenkt werden, erklärte Prof. Puig, wenn das Screening auf Menschen mit mindestens einem Risikofaktor beschränkt wurde. Doch wichtiger als ein Screening ist es in ihren Augen, Personen mit vorherigen Melanomen gut zu überwachen. Ihr konkreter Vorschlag: Sich fokussieren auf Primärprävention, sekundäre Prävention nur für Risikogruppen und Tertiärprävention im Sinne von gutem Zugang zum Follow-up.
Kann Technologie das nicht übernehmen?
Vergangenes Jahr startete Dr. Katrien Vossaert aus Gent ein Pilotprojekt für eine andere Form des Screenings: Ihr Team richtete ein reines Bildgebungszentrum ein, ausgestattet mit einem 3D-Ganzkörperscanner und Assistent:in. Es kann auf Eigeninitiative hin aufgesucht werden oder man wird dorthin überwiesen. Die Besucher:innen füllen einen Fragebogen aus, erhalten ihren Scan und auf Basis des KI-generierten Pizzadiagramms fertigt die Assistenz zusätzliche dermatoskopische Bilder an und kontrolliert Plantarhaut, Hautfalten und Kopfhaut. Ein:e Dermatolog:in begutachtet später die Bilder und erstellt einen medizinischen Bericht sowie einen für Laien. „Wird eine verdächtige Läsion gefunden, verweisen wir die betreffende Person weiter an ihren Hausarzt oder ihre behandelnde Dermatologin“, erklärte die Referentin. In der Entscheidungsfindung handele es sich also um eine Kollaboration zwischen KI und menschlicher Beurteilung.
Das Konzept führe zu einer Entlastung der Facharztpraxen. Von denjenigen Besucher:innen, die auf Eigeninitiative hin kamen und einem niedrigen bis mittleren Risiko zugeordnet wurden, benötigten rund 10 % einen Termin zur Abklärung einer Läsion. Die Numbers Needed to Excise lagen mit rund 2–3 im niedrigen Bereich, die Gesamtdetektionsrate betrug 4,8 %.
Quelle:
Vossaert K. 21st EADO Congress; SYMPOSIUM SY02 „Population screening using total body imaging“
Es geht um mehr als die Mortalität
Als Verteidiger des Screenings trat Prof. Dr. Peter Mohr von den Elbekliniken in Buxtehude an.2 Es ginge nicht einzig darum, die krankheitsspezifische Mortalität zu senken, sondern z. B. auch die Krankheitslast zu reduzieren oder die Lebensqualität zu verbessern. Mögliche Schäden des Screenings beschränkten sich auf eher theoretische Themen wie Über- oder Fehldiagnosen. Das Fazit des G-BA in Deutschland laute: „Ein Screening könnte relevante Vorteile haben und es scheint keine wirklichen Nachteile zu geben“, fasste der Referent zusammen.
Inwiefern ein Screening die Morbidität durch Nicht-Melanom-Tumoren reduziere, dazu gebe es leider „absolut keine Daten“, bedauerte Prof. Mohr. Melanome allerdings seien dünner, wenn sie im Screening erkannt werden. Laut einer retrospektiven Kohortenstudie aus Sachsen hatten Melanompatient:innen, die am Screening teilgenommen hatten, zudem weniger Metastasen, benötigten weniger Systemtherapien und wiesen signifikant bessere Überlebensraten auf. Dass die Melanomsterblichkeit in Deutschland niedriger liegt als z. B. in den Niederlanden, führte er neben der höheren Screeningaktivität auf mehr Primärprävention zurück sowie eine kürzere Termin-Wartezeit.
Sein Fazit: Trotz fehlenden randomisierten Beweises einer gesenkten Mortalität, sei das Screening in der Masse machbar und sinnvoll. Für eine Effizienzsteigerung durch risikoabhängige Vorgehensweisen zeigte sich der Referent aber offen.
Quellen:
1. Puig S. 21st EADO Congress; SYMPOSIUM SY01 „Controversies – Skin cancer screening should be abandoned!“; Position: „Yes“
2. Mohr P. 21st EADO Congress; SYMPOSIUM SY01 „Controversies – Skin cancer screening should be abandoned!“; Position: „No“



