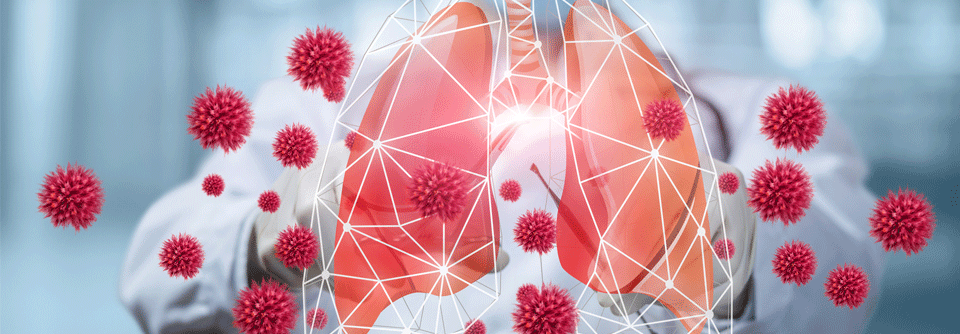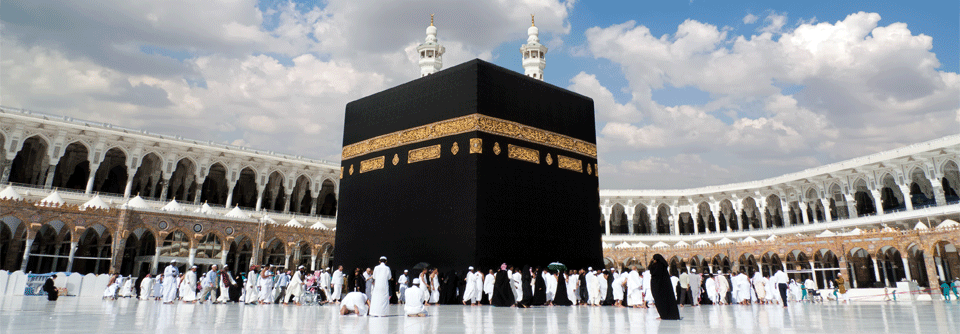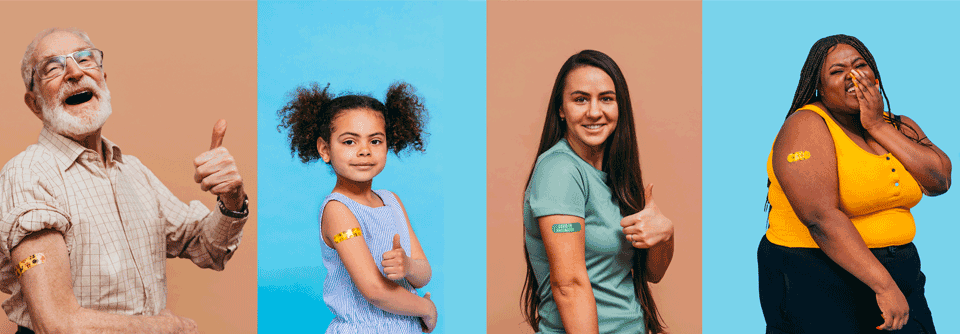
Masken im Einsatz Schutzfaktor oder politische Diskussion?
 Die offiziellen US-Empfehlungen zum Tragen einer Gesichtsmaske änderten sich während der COVID-19-Pandemie mehrfach.
© Yura Yarema – stock.adobe.com
Die offiziellen US-Empfehlungen zum Tragen einer Gesichtsmaske änderten sich während der COVID-19-Pandemie mehrfach.
© Yura Yarema – stock.adobe.com
Die offiziellen US-Empfehlungen zum Tragen einer Gesichtsmaske änderten sich während der COVID-19-Pandemie mehrfach. Im Verlauf wurde das Aufsetzen von Masken gar politisiert. Inzwischen gibt es zahlreiche, teils widersprüchliche Studien zu der Frage, welchen Schutz die verschiedenen Maskentypen im Gesundheitswesen und in der Öffentlichkeit bieten.
Nach einer ersten Publikation zum Thema trug ein Forscherteam um Prof. Dr. Raina MacIntyre von der Universität New South Wales in Sydney nun erneut Daten zu diesem Thema zusammen. Besonders interessierte das Team, welchen Effekt die einzelnen Maskentypen bei den unterschiedlichen Erregern von Atemwegsinfektionen haben.
Auf Grundlage der Daten aus sieben randomisiert kontrollierten Studien (RCT) zum Nutzen von Masken im medizinischen Bereich ergab sich: Ein Atemschutz der Kategorie FFP2 und N95 beugte einer respiratorisch übertragbaren Infektion effektiver vor als einfache medizinische Gesichtsmasken. Dabei ist entscheidend, dass das Personal eine gut sitzende Atemschutzmaske kontinuierlich trägt – nicht nur zeitweise in Hochrisiko-Situationen mit Kontakt zu Infizierten. Denn während einer Pandemie eines aerogen übertragenen Erregers besteht in Kliniken auch infolge der Belüftungssysteme praktisch überall ein erhöhtes Infektionsrisiko.
Um den primären Schutz gesunder Personen in der Gesellschaft durch Masken ging es in zwölf RCT. Die Studien kamen zu teilweise recht unterschiedlichen Ergebnissen. Die Daten deuten aber darauf hin, dass die Nutzung von Masken in Phasen einer hohen Transmission einen signifikanten Schutz vor Infektionen bietet. Dies galt insbesondere, wenn die Masken frühzeitig aufgesetzt wurden, die Personen den Regeln zum Tragen einer Maske folgten und eine gute Handhygiene beachteten. In Kombination mit guter Handhygiene zeigte auch eine kürzlich veröffentlichte Metaanalyse einen effektiven Schutz vor Influenza bzw. grippeähnlichen Erkrankungen, wenn Masken genutzt werden.
Für die Gruppe der Kinder und Jugendlichen ließ sich zwar keine RCT finden. Andere Untersuchungen legen aber insgesamt nahe, dass die Infektionsgefahr in der Schule sinkt, wenn dort Masken getragen werden.
Mögliche Alternative bieten in manchen Fällen Stoffmasken
Gerade am Anfang der Pandemie waren medizinische Masken knapp. Als Alternative können außerhalb des Gesundheitssystems Stoffmasken dienen, sofern diese nach der Nutzung bei 60 °C gewaschen werden. Insgesamt sind Stoffmasken aber weniger effektiv als die medizinischen Masken und diesen unterlegen, vor allem solchen der FFP2- oder N95-Atemschutzklasse. Müssen Letztere sehr lange oder wiederholt verwendet werden, sind häufiges Händewaschen und eine geeignete Aufbewahrung sowie Dekontamination genutzter Masken wichtig. Zur Frage der Sicherheit solcher Praktiken und der Nachhaltigkeit der verschiedenen Produkte sprechen sich die Autorinnen und Autoren grundsätzlich für mehr Forschung in dieser Hinsicht aus.
Empfehlungen zum Tragen von Masken während einer Pandemie sollten sich nach Ansicht des Autorenteams immer am Setting (Klinik, Haushalt, Öffentlichkeit), der Phase der Pandemie und dem jeweiligen Erreger orientieren. Beispielsweise wird geschätzt, dass 30–50 % der SARS-CoV-2-Übertragungen asymptomatisch verlaufen, weshalb bei Infektionswellen des Coronavirus Masken auf breiter Front getragen werden sollten. Angesichts einer drohenden Pandemie mit dem H5N1-Virus gelte es, ausreichend Schutzmasken zu bevorraten, vernünftige Richtlinien zu entwickeln und gegen Falschinformationen vorzugehen.
Quelle: MacIntyre CR et al. BMJ 2025; 388: e078573; DOI: 10.1136/bmj‑2023‑078573