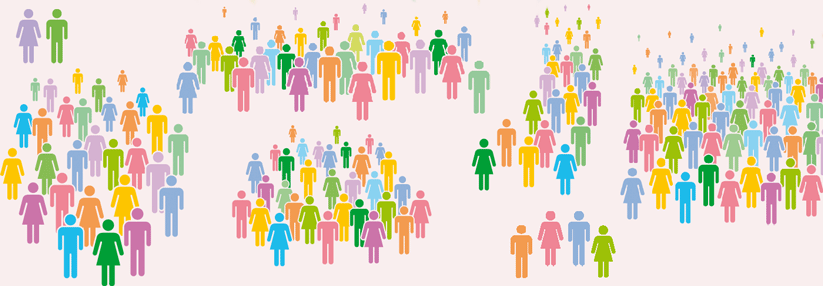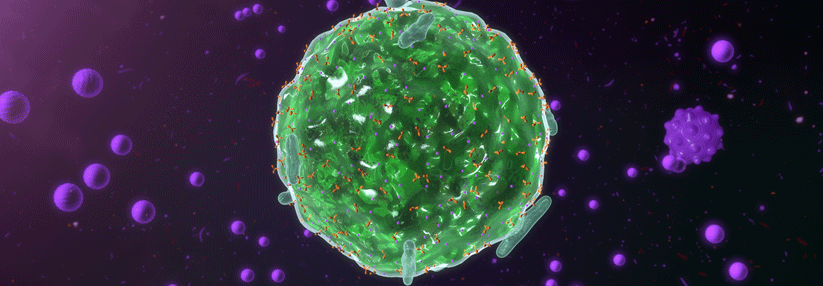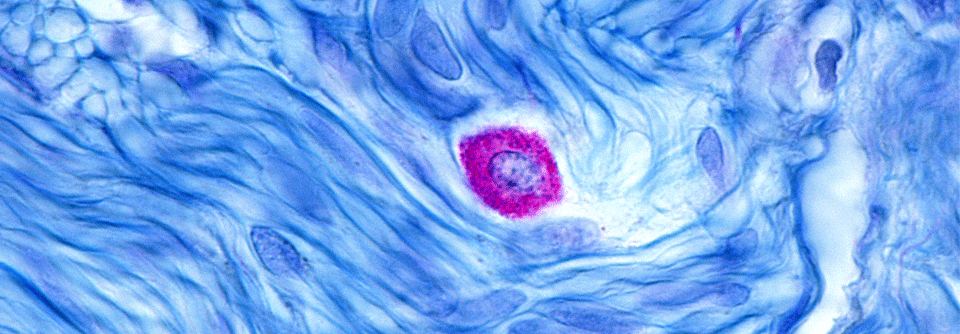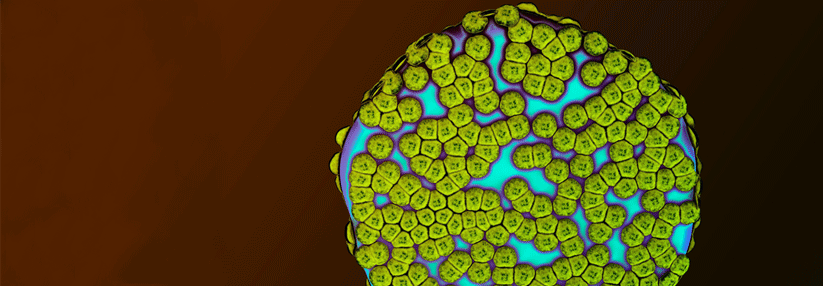
Mastzellerkrankungen und Psyche Stressiger Teufelskreis
 Die angeborene Mastozytose zeigt sich bei diesem Kleinkind als fleckige Urticaria pigmentosa.
© wikicommons/James Heilman, MD
Die angeborene Mastozytose zeigt sich bei diesem Kleinkind als fleckige Urticaria pigmentosa.
© wikicommons/James Heilman, MD
Mastzellerkrankungen wie die Mastozytose sind bislang wenig erforscht. Sie gelten als selten, kommen aber wahrscheinlich häufiger vor als bisher angenommen. Unsicherheit besteht nicht nur hinsichtlich der Prävalenz dieser Erkrankungen, auch über die psychischen Auswirkungen ist wenig bekannt. Da Mastzellen nachweislich auf psychischen Stress reagieren, ist zu vermuten, dass die Art der Krankheitsbewältigung das Beschwerdebild zum Guten oder zum Schlechten beeinflussen kann.
Mastzellerkrankungen sind aus unterschiedlichen Gründen für die Patienten sehr belastend. Das hat zum einen mit den vergleichsweise geringen Kenntnissen über diese Störung zu tun, was u.a. dazu führt, dass im Schnitt 6,5 Jahre vergehen, bis die Diagnose gestellt wird. Zum anderen sorgen das komplexe und variable klinische Bild sowie der im individuellen Fall nicht vorhersehbare Verlauf für eine Unsicherheit, mit der die Patienten dauerhaft leben lernen müssen. Schließlich lässt sich das Leiden nicht heilen. Besonders belastend ist das stetige Risiko lebensbedrohlicher anaphylaktischer Reaktionen.
Es überrascht deshalb nicht, dass Mastzellerkrankungen eine hohe psychische Komorbidität aufweisen. Mit Blick auf Depressionen gibt es dazu einige Evidenz, wobei die Prävalenzangaben von 40–70 % reichen. Zur Prävalenz von Angststörungen fehlen dagegen belastbare Daten.
Mit dem Ziel, Zusammenhänge zwischen körperlichen Beschwerden und Ängsten aufzudecken, wurde in einer US-amerikanischen Studie bei 157 Patienten mit Mastzellerkrankungen eine anonymisierte, 90-minütige, internetbasierte Umfrage durchgeführt.
Jeder Dritte hat Angstzustände
Auch für die verschiedenen Copingstrategien der Patienten interessierten sich Dr. Jennifer Nicoloro-SantaBarbara vom Department of Psychology, University of California, und Kollegen. Mehr als die Hälfte der Befragten erlebte ihre Erkrankung als sehr stressig und fast ein Drittel gab an, unter mittelschweren Angstzuständen zu leiden. Dabei war eine Korrelation zwischen dem Ausmaß der Ängste und dem Ausmaß der körperlichen Symptome festzustellen. Weiter ergab die Befragung, dass Patienten, die lösungsorientierte Copingstrategien anwendeten, weniger Angst hatten. In den meisten Fällen bezog sich dies auf Stressoren in Zusammenhang mit ihrer Erkrankung aus den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Arbeit oder soziale Beziehungen.
Vermeidungsstrategien dagegen scheinen kontraproduktiv zu sein und Ängste eher zu schüren. Stabilisierend und angstmindernd wirkte sich zudem ein unterstützendes soziales Umfeld aus, auch das zeichnete sich bei der Befragung ganz klar ab. Die Patienten erreichten im Schnitt einen Social-Support-Score von 3,42, d.h., sie konnten sich „für einige Zeit“ auf Unterstützung verlassen.
Betroffene von Anfang an psychisch unterstützen
Die Autoren halten es aufgrund der Umfrageergebnisse für angezeigt, die psychische Dimension von Mastzellerkrankungen im Blick zu haben. Die Patienten sollten durch geeignete Angebote bei der Krankheitsbewältigung unterstützt werden mit dem Ziel, die Lebensqualität zu fördern und das Risiko von Ängsten und Depressivität zu reduzieren. Hierbei können Erfahrungen mit anderen Erkrankungen wie etwa Brustkrebs oder rheumatoider Arthritis hilfreich sein.
Quelle: Nicoloro SantaBarbara J et al. Ann Allergy, Asthma Immunol 2021; DOI: 10.1016/j.anai.2021.06.014