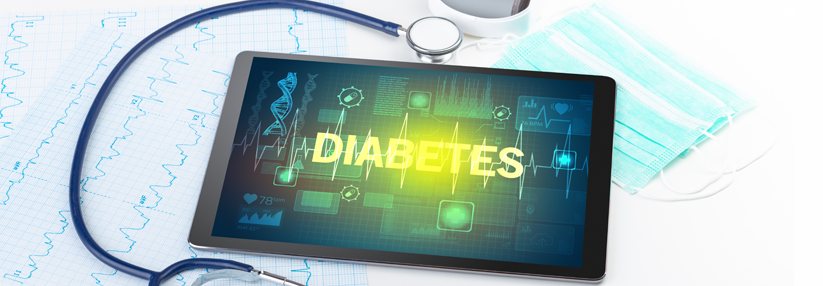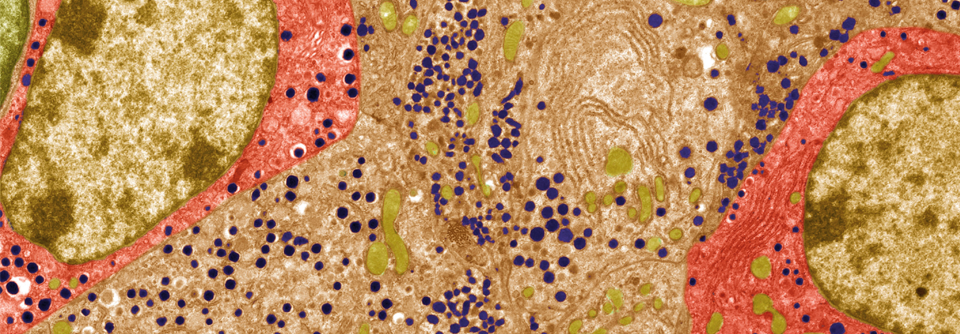Pandemie Typ-1-Diagnose häufig erst spät gestellt
 Schwere Stoffwechselentgleisungen traten im Lockdown häufiger auf, besonders bei Kindern.
© Africa Studio – stock.adobe.com
Schwere Stoffwechselentgleisungen traten im Lockdown häufiger auf, besonders bei Kindern.
© Africa Studio – stock.adobe.com
Dass Diabetespatient*innen einer Risikogruppe für einen schweren COVID-Verlauf angehören, ist bekannt. Auffällig seien jedoch Pandemieeffekte, die sich bei den Typ-1-Diabetes-Neuerkrankungen zeigten, erklärte Prof. Dr. Hans Hauner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Diabetes Stiftung (DDS). Seit Beginn der Coronapandemie konnten die Forscher*innen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von bis zu 18 Jahren eine erhöhte Rate an diabetischen Ketoazidosen mit Typ-1-Diabetes-Manifestation beobachten, besonders bei Kindern unter sechs Jahren.
Dies deutet darauf hin, dass die Typ-1-Diabetes-Diagnose in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie verspätet gestellt wurde, so Dr. Stefanie Lanzinger, Universität Ulm. Ihre Aussage stützt sie auf aktuelle Daten aus dem DPV-Register, einer multizentrischen Verlaufsdokumentation von Diabetespatient*innen, die Routinedaten aller Diabetestypen erfasst.
Ursachen für die erhöhte Inzidenz sind noch unklar
Eine Analyse dieser Daten für das Gesamtjahr 2020 und das erste Halbjahr 2021 zeigte, dass sich die Inzidenz des Typ-1-Diabetes im Vergleich zu den Jahren 2011 bis 2019 um 15 % erhöht hat. Als mögliche Erklärung nannte Dr. Lanzinger indirekte Effekte der Pandemie wie eine erhöhte psychische Belastung, die eine Manifestation triggern kann. Als fast doppelt so hoch erwies sich das relative Risiko einer diabetischen Ketoazidose bei einer Typ-1-Diabetes-Manifestation, die bei Kindern und Jugendlichen in der ersten Lockdownphase von März bis Mai 2020 festgestellt wurde (verglichen mit dem gleichen Zeitraum von 2018 und 2019), was vor allem die unter 6-Jährigen betraf.
Wer gut durch den Lockdown kam
Bei jungen Menschen unter 18 Jahren mit einem manifesten Typ-1-Diabetes ließen sich jedoch keine Veränderungen in der Stoffwechseleinstellung während der ersten Lockdownphase beobachten. Ähnlich sehen die Ergebnisse auch bei Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes aus. Dies zeige, dass Patient*innen, deren chronische Diabeteserkrankung bereits vor der Pandemie behandelt worden war, „gut durch die Lockdownphasen gekommen“ seien, sagte Dr. Hauner.
Eine der, von der DDS geförderten, Studien kam für Menschen mit Typ-2-Diabetes zu einem ähnlichen Fazit. Denn nach dem ersten Lockdown hätte diese Gruppe weder eine schlechtere Stoffwechseleinstellung noch einen höheren Body-Mass-Index (BMI) aufgewiesen, so PD Dr. Dr. Bernd Kowall, Universität Duisburg-Essen. Dies gelte auch für die Rate an psychischen Störungen, die unverändert geblieben sei.
Als mögliche Gründe führte er u.a. die langjährige Erfahrung im Diabetesselbstmanagement der untersuchten Typ-2-Patient*innen, das hohe Durchschnittsalter der Betroffenen von 68 Jahren, die sich nicht mit belastenden Themen wie Homeoffice-Regelungen auseinandersetzen mussten, und die in der Pandemie schnell eingeführten Angebote von Videosprechstunden und -schulungen durch diabetologische Schwerpunktpraxen.
Nur wenige Daten zur Diabetesversorgung
Dr. Paula Friedrichs, BioMath GmbH, Rostock, stellte die Ergebnisse einer systematischen Recherche (Scoping-Review) von Versorgungsdaten vor (Zeitraum: 29. März bis 10. Mai 2021). Das Forschungsteam fand u.a. heraus, dass es in Deutschland nur wenige Studien zur Versorgungssituation von Menschen mit Diabetes gibt (lediglich zwölf relevante empirische Studien). „Die Evidenzlücken im Recherchezeitraum hinsichtlich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie [auf deren Versorgung] waren noch sehr groß“, betonte sie.
Versorgungsdaten müssen zeitnah verfügbar sein
Relevante Routinedaten seien ebenfalls nicht zeitnah verfügbar, sagte sie. Im Rahmen des Scoping-Reviews wollten die Wissenschafler*innen etwa GKV-Routinedaten, Daten aus Patientenregistern und vertragsärztliche Abrechnungs- und Arzneiversorgungsdaten analysieren. Eine direkte Anfrage u.a. bei Kassen und Patientenregistern blieb jedoch ohne Ergebnis.
Die zeitnahe Verfügbarkeit solcher Routinedaten außerhalb von laufenden Studien scheint nicht möglich zu sein. Dies hätte jedoch ein großes Potenzial für die Versorgungsforschung, weshalb die Daten schneller und besser genutzt werden sollten, so Dr. Friedrichs. „Wir benötigen echte, ,reale‘, Versorgungsdaten, um die tatsächlichen Probleme identifizieren und gezielt adressieren zu können“, richtete Dr. Hauner seinen Appell an Politik und Krankenkassen.
Als positiv für Betroffene und ihre Diabetesteams wertete der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Diabetes Stiftung den digitalen Wandel, der durch die Pandemie angeschoben worden sei. Digitale Diabetesberatungen und -schulungen seien inzwischen in vielen diabetologischen Einrichtungen fester Bestandteil, die neuen Online-Optionen wie Videosprechstunden auch langfristig von Vorteil, erklärte er.
Quelle: Online-Pressekonferenz der Deutschen Diabetes Stiftung