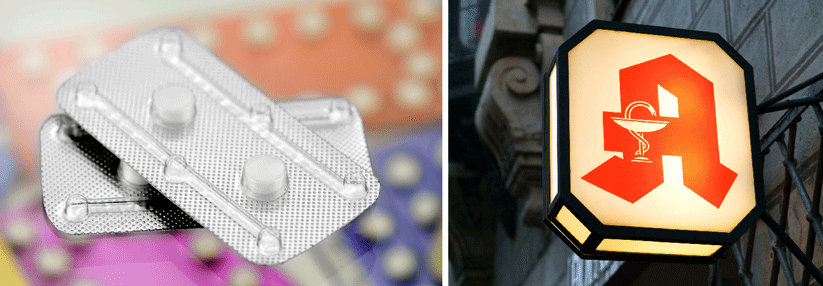Muslimische Patienten Welche Besonderheiten es bei muslimischen Patienten zu beachten gilt
 Die Referenten betonten, dass es in der Psychotherapie nicht darum gehen sollte, sich auf religiöse Diskussionen einzulassen oder spirituelle Vorstellungen zu hinterfragen. (Agenturfoto)
© Elnur – stock.adobe.com
Die Referenten betonten, dass es in der Psychotherapie nicht darum gehen sollte, sich auf religiöse Diskussionen einzulassen oder spirituelle Vorstellungen zu hinterfragen. (Agenturfoto)
© Elnur – stock.adobe.com
Zum Islam bekennen sich in Deutschland rund fünf Millionen Menschen. Für viele praktizierende Muslime gehört die Religion zu ihrem Selbstverständnis und nimmt im Alltagsleben eine wichtige Rolle ein. Das gilt auch für den Umgang mit Belastungen und seelischen Erkrankungen. „Den ‚typischen‘ muslimischen Patienten gibt es aber nicht“, stellte der in Berlin niedergelassene Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Dr. Basel Allozy klar. Genau wie bei Angehörigen anderer Religionen gebe es große Unterschiede in Bezug auf ethnische Herkunft, Religiosität, politische Einstellungen, Bildungsstand und sozioökonomischen Status.
Religion und Kultur vermischen sich häufig
Der Islam wirkt sich oft schon früh im Leben auf die familiären Beziehungen aus, sagte der Kollege. Er behandelt schwerpunktmäßig muslimische Kinder und Jugendliche. In manchen Familien gelten die Eltern als absolute Vorbilder und Respektspersonen, denen man nicht widersprechen darf. Dabei vermischen sich häufig Religion und kulturelle Traditionen. Patriarchale Strukturen etwa gehen auf bestimmte Kulturräume zurück, aber nicht zwangsläufig auf den Islam, erklärte der Psychiater.
Die Pubertät stürzt viele muslimische Jugendliche in Verunsicherung. Anders als viele ihrer Altersgenossen werden sie in dieser Entwicklungsphase häufig mit Themen wie Hölle und Paradies, Sünde, Reue und religiösen Verboten konfrontiert. Dies kann Orientierungsprobleme und Loyalitätskonflikte verstärken, so Dr. Allozy. Seine Patienten fühlten sich häufig zwischen modernen und traditionellen Werten hin- und hergerissen. In der Praxis beobachtet der Psychiater gehäuft:
- Störungen des Sozialverhaltens (u.a. „Machogehabe“). Sie resultieren oft aus Selbstwertproblemen und Ängsten.
- Zwangsstörungen. Sind diese religiös konnotiert, basieren sie meist auf Schuld, Scham und Angst.
- Depression und sozialer Rückzug. Sie treten häufig in Verbindung mit Leistungsdruck, hohen Erwartungen der Eltern und Vorurteilen der Gesellschaft auf.
Wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema sind noch rar, erklärte Dr. Allozy. „Wichtig ist, dass es kein einheitliches Muster gibt – jedes Kind ist anders!“ In der Anamnese gilt es daher immer herauszufinden, welche Rolle die Religion für den einzelnen Patienten spielt. Man kann z.B. fragen: „Wenn du in Not bist und Angst hast, an wen würdest du dich wenden? Was könnte dir helfen?“ Ergibt sich kein Hinweis auf eine ausgeprägte Religiosität, darf man diese Dimension in der Therapie vernachlässigen.
Versorgungslücken bei älteren Muslimen
Derzeit leben in Deutschland rund 280.000 Muslime im Alter über 65 Jahre. Diese Zahl wird sich bis 2030 verdoppeln, sagte Dr. Ahmad Bransi, Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Weserbergland. Häufig leiden diese Menschen an klassischen Alterskrankheiten, aber auch an Depression und somatoformen Störungen. Für sie klaffen psychotherapeutische Versorgungslücken, zumal es in muslimischen Familien üblich ist, die Großeltern zu Hause zu pflegen und nur selten Therapie in Anspruch zu nehmen.
Auch in der mittleren Lebensphase können Weltbild und Selbstverständnis von Muslimen religiös oder traditionell geprägt sein, berichtete Malika Laabdallaoui, Psychotherapeutin in Rüsselsheim am Main. Dass Menschen mit Migrationshintergrund seltener eine ambulante Psychotherapie in Anspruch nehmen, liege aber vor allem an einem Mangel an Therapeuten mit muslimischem Hintergrund. Laabdallaoui ist auf die Behandlung muslimischer Frauen spezialisiert, manche ihrer Patientinnen nehmen einen Anfahrtsweg von 300 km in Kauf. Grund sei die Angst davor, dass nicht-muslimische Therapeuten Vorurteile haben oder sie nicht verstehen könnten. Zudem haben manche bereits erlebt, dass ihre Kultur oder Religion in der Therapie problematisiert wurden.
Deutschstämmige Kollegen brauchen mehr kulturelle Offenheit und Sensibilität, denn viele „verstehen gar nicht, was Menschen mit Migrationshintergrund täglich erleben“, so Laabdallaoui. Jede dritte ihrer Patientinnen gab in einer Befragung an, dass Rassismus und Diskriminierung für sie zu den größten Belastungen gehören. Hinzu kommen die Benachteiligung aufgrund des Geschlechts, bisweilen auch Armut und fehlende Sprachkenntnisse.
Viele muslimische Frauen fühlen sich verpflichtet, ihren Verwandten in ärmeren Herkunftsländern zu helfen, berichtete Laabdallaoui. Diese Praxis werde oft von den Eltern und Großeltern übernommen, auch wenn der eigene Bezug zu den Verwandten meist geringer ist. Patientinnen, die neu in Deutschland sind, haben oft selbst die Fluchterfahrungen gemacht. Sie kämpfen mit diesem biografischen Bruch, mit Traumatisierung und dem Verlust ihrer gesellschaftlichen Stellung. Religion ist dabei keineswegs immer eine Bürde: Zwei Drittel der von Laabdallaoui befragten Patientinnen bezeichnen sie als Ressource. Für 15 % stellt sie eine zusätzliche Belastung dar; ein Viertel sieht keinen Einfluss auf das seelische Wohlergehen.
Gesprächsgruppen für Männer oft sehr erfolgreich
Muslimische Männer werden in Deutschland oft klischeehaft und vorurteilsbeladen wahrgenommen, beklagte der ebenfalls in Rüsselsheim niedergelassene Psychiater und Psychotherapeut Dr. Ibrahim Rüschoff. Wahr sei, dass die Familie für Muslime oft eine noch wichtigere Rolle spiele als für nicht-muslimische Patienten. Auch Erwachsene empfänden häufig Schuldgefühle gegenüber ihren Eltern. Typisch sei außerdem das Verharren in traditionellen Geschlechterrollen, oft weil die Patienten keine gute Alternative dazu kennen. Gesprächsgruppen für Männer könnten da oft erstaunlich gute Dienste leisten.
Die Referenten betonten, dass es in der Psychotherapie nicht darum gehen sollte, sich auf religiöse Diskussionen einzulassen oder spirituelle Vorstellungen zu hinterfragen. Auf psychologischer Ebene sei es nicht wichtig, was der Islam wirklich sagt oder nicht. Man müsse mit dem arbeiten, was die Patienten glauben.
Quelle: DGPPN-Kongress 2022