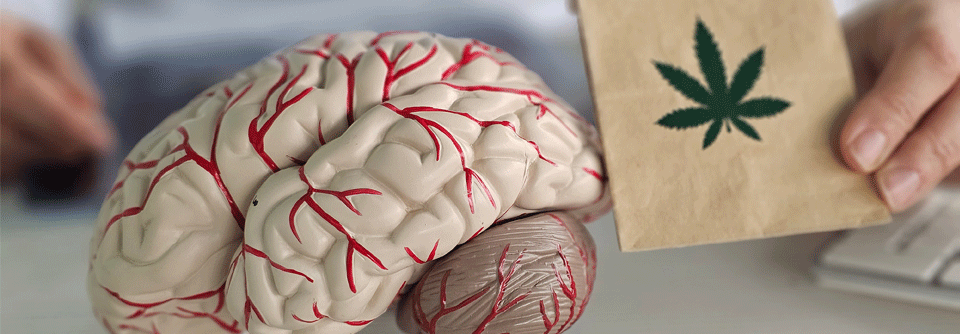Zwischen Euphorie und nüchterner Evidenz Wo medizinisches Cannabis glänzt – und wo eher nicht
 Die wichtigsten Wirkstoffe von Cannabis sind Delta-9-Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol, kurz THC bzw. CBD.
© Proxima Studio - stock.adobe.com
Die wichtigsten Wirkstoffe von Cannabis sind Delta-9-Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol, kurz THC bzw. CBD.
© Proxima Studio - stock.adobe.com
Die wichtigsten Wirkstoffe von Cannabis sind Delta-9-Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol, kurz THC bzw. CBD. THC wirkt agonistisch an den endogenen Cannabinoidrezeptoren CB1 und CB2 und reduziert die exzitatorische Neurotransmission. Das führt zu Entspannung, Appetitsteigerung, Spasmusminderung/Muskelrelaxation und Schmerzlinderung, hat aber auch antiinflammatorische und immunmodulierende Effekte. CBD hingegen besitzt ein sogenanntes Multi-Target-Profil, erläutern Dr. Otto Dietmaier, Klinikum am Wiessenhof in Weinberg, und Prof. Dr. Gerd Laux, Institut für Psychologische Medizin in Soyen. CBD wirkt nicht nur antagonistisch am CB1-Rezeptor, es interagiert zudem mit den 5-HT1A-Serotonin-, Dopamin-D2-, µ-Opioid- und Adenosin-A1-Rezeptoren. Es wirkt antiepileptisch, antiinflammatorisch und angstlösend.
Medizinisches Cannabis bleibt verschreibungspflichtig
Mit der Teillegalisierung von Cannabis zu Konsumzwecken trat im vergangenen Jahr auch das Medizinal-Cannabisgesetz in Kraft. Demnach bleibt Cannabis zur medizinischen Anwendung apotheken- und verschreibungspflichtig. Mit Ausnahme von Nabilon unterliegt es aber nicht mehr dem Betäubungsmittelgesetz. Verordnet werden darf ein Cannabispräparat dann, wenn
- die Erkrankung schwerwiegend ist,
- Standardtherapien nicht ausreichend wirken, nicht vertragen werden oder kontraindiziert sind,
- berechtigte Aussicht auf Besserung besteht.
Cannabispräparate dürfen nur von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden. Innerhalb der zugelassenen Indikation ist keine Genehmigung durch die Krankenkasse erforderlich. In Deutschland sind als Fertigarzneimittel erhältlich: - Nabilon, ein synthetisches THC-Derivat
- Cannabidiol als Reinsubstanz
- Nabiximols, ein standardisierter Cannabisextrakt
Nabilon ist bei zytostatikainduzierter Übelkeit und Erbrechen zugelassen, Cannabidiol bei bestimmten seltenen Epilepsieformen, Nabiximols bei Spastiken infolge Multipler Sklerose. Dronabinol, bei dem es sich um THC als Reinsubstanz handelt, ist als Rezeptursubstanz verordnungsfähig, in Deutschland aber nicht erhältlich. Daneben sind eine Vielzahl verschiedener Cannabisblüten und -extrakte auf dem Markt, die sich durch ihren THC-Gehalt und das THC/CBD-Verhältnis unterscheiden.
Etwa drei Viertel aller Cannabisverordnungen in Deutschland erfolgen wegen chronischer, vor allem neuropathischer Schmerzen. Die Evidenz für einen Effekt in dieser Indikation ist allerdings nur moderat, betonen Dr. Dietmeier und Prof. Laux. Es existiert eine Vielzahl von Studien und Untersuchungen mit teils uneinheitlichen Ergebnissen, von denen die meisten von positiven Resultaten berichten. Eine Wirkung bei akuten Schmerzen hat die Cannabismedizin hingegen nicht.
Zum Einsatz bei psychischen Erkrankungen ist die Datenlage unklar. Eine Zulassung cannabishaltiger Fertigarzneimittel für diese Indikationen besteht nicht. Nach Ansicht der Autoren sind große, ausreichend kontrollierte Studien dringend notwendig, um das Potenzial von Cannabis in diesem Bereich weiter zu erforschen. Sie stufen cannabisbasierte Arzneimittel prinzipiell als gut verträglich ein, verweisen aber auf die typischen Nebenwirkungen. Recht häufig kommt es etwa bei THC-haltigen Präparaten zu Schwindel und Müdigkeit, bei Cannabidiol stehen u.a. Appetitminderung und Leberwerterhöhungen im Vordergrund.
Das Autorenduo warnt ausdrücklich vor den Gefahren des nicht-medizinischen Cannabiskonsums. Sie halten zudem die im Gesetz geregelte Menge an Cannabis, die eine einzelne Person besitzen darf, für zu hoch.
Quelle: Dietmaier O, Laux G. Psychopharmakotherapie 2025; 32: 11-24