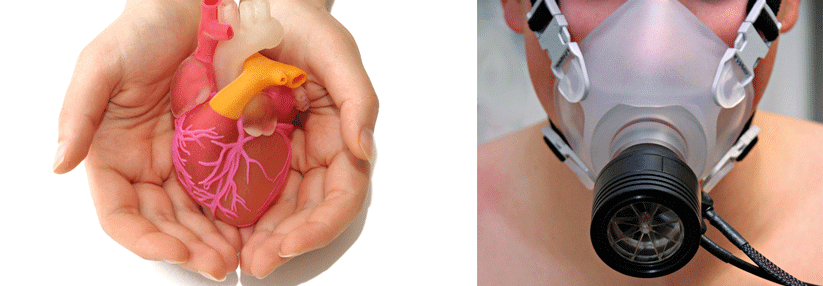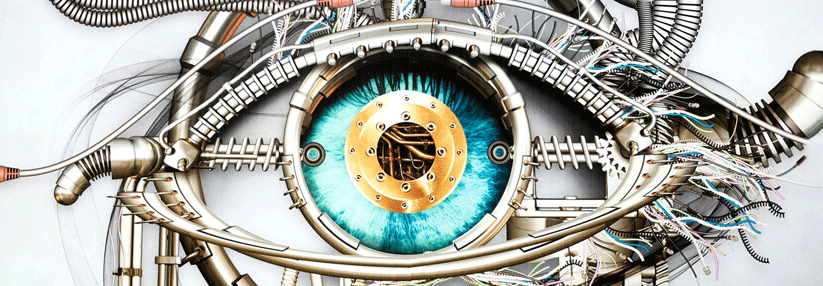Zwei Experten streiten über den Stellenwert von Risikoscores
 Sind Risikoscores nur moderne Kristallkugeln?
© TANABOON – stock.adobe.com
Sind Risikoscores nur moderne Kristallkugeln?
© TANABOON – stock.adobe.com
Über den Nutzen der Prognoseinstrumente im klinischen Alltag redeten sich Professor Dr. Rodney Jackson, University of Auckland, und Professor Dr. Lars Ryden, Karolinska-Institut Stockholm, die Köpfe heiß. Der neuseeländische Epidemiologe ist fest überzeugt, dass nur mithilfe von Scores eine informierte Therapieentscheidung gelingt. Der schwedische Kardiologe hält sie dagegen für „eine moderne Variante der Kristallkugel“.
Prof. Jackson argumentierte, dass der kombinierte Effekt multipler Faktoren das kardiovaskuläre Risiko bestimmt. Ein Blutdruckanstieg um 5 mmHg systolisch wirkt sich bei einem sonst gesunden 35-Jährigen ganz anders aus als bei einem 65-jährigen, kettenrauchenden Diabetiker. Der Nutzen der Intervention korreliert direkt mit dem prätherapeutischen Risiko, und den größten Vorteil haben die mit dem höchsten Ausgangsrisiko. Sprich: 15 % Reduktion bewirken im Falle eines absoluten Risikos von 2 % in zehn Jahren eben etwas anderes, als wenn es 20 % beträgt. „Ohne das Risiko vorab zu kennen, ist jede Behandlung ein Schuss ins Blaue.“
Netter Versuch, meinte Prof. Ryden, aber die Messlatten sollten erst mal beweisen, dass sie allgemein nützen und dass ihre Anwendung das Outcome verbessert. „Junge Menschen, Frauen und Hochbetagte sind unterrepräsentiert in den Studien, auf die sich diese Scores stützen.“ Dass keines der Prognoseinstrumente wirklich taugt – auch nicht das der europäischen Kardiologen – zeigt sich seiner Ansicht nach schon daran, dass allein in englischer Sprache mehr als 15 davon online existieren.
Was soll ein Patient denken, dem der Kardiologe anhand eines Rechners ein Zehnjahresrisiko von 10 % prophezeit und der Hausarzt mit einem anderen eines von 4 %? Dass es sich im ersten Fall um die Wahrscheinlichkeit eines Infarkts und im zweiten um die der kardiovaskulären Mortalität handelt, kommt dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr bei ihm an.
Vom Kalkulator der ESC hält auch Prof. Jackson nicht viel. Er sei viel zu ungenau, die Datenbasis zu alt. Der Kollege zieht ein internetbasiertes Tool vor, das wesentlich mehr Informationen einbezieht, u.a. auch Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz und Familienanamnese. Es nutzt vier verschiedene Datensets.
Um Adipositas zu verhindern, braucht man keinen Score
Wenn es nur um die Datenbasis ginge, ließe sich das Problem vermutlich mit ein bisschen Aufwand sogar lösen. Prof. Ryden betrachtet es aber als viel entscheidender, dass die Anwendung in der klinischen Praxis viel zu umständlich ist: „Das macht kein Kollege, wenn er dem Patienten gegenübersitzt.“ Die wichtigste risikomindernde Maßnahme auf Bevölkerungsebene sei ohnehin, Übergewicht bereits im Kindesalter zu verhindern. „Das ist schwierig genug, und man braucht überhaupt keinen Score dafür.“
Kongressbericht: European Society of Cardiology (ESC) Congress 2019