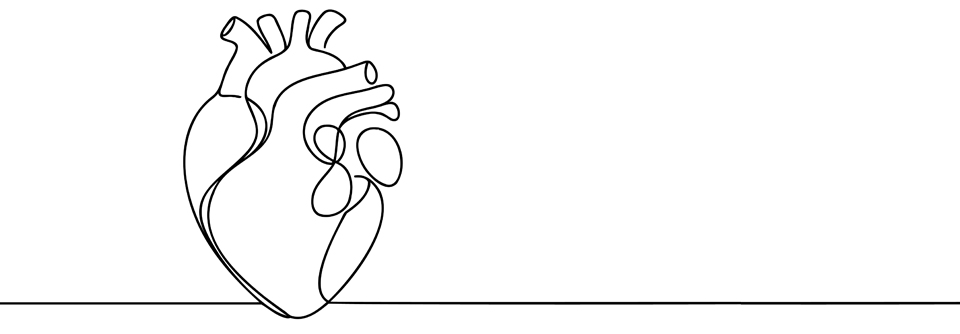Hilfe für die Beihilfe Wie man im Ernstfall den assistierten Suizid mit Rechtssicherheit umsetzt
 Eine Handlungsempfehlung der DEGAM für den Umgang mit dem Wunsch nach Suizidassistenz hilft Ärztinnen und Ärzten, prekäre rechtliche Situationen zu vermeiden.
© Andrey Popov - stock.adobe.com
Eine Handlungsempfehlung der DEGAM für den Umgang mit dem Wunsch nach Suizidassistenz hilft Ärztinnen und Ärzten, prekäre rechtliche Situationen zu vermeiden.
© Andrey Popov - stock.adobe.com
Wird ein Sterbewunsch mit Bitte um Suizidbeihilfe an die Hausärztin oder den Hausarzt herangetragen, stellt sich zunächst die Frage nach der rechtlichen Situation. Bei einem freiverantwortlichen Suizid ist die ärztliche Assistenz straffrei. Mediziner sind aber zur Beihilfe nicht verpflichtet. Zur Klärung der Frage, ob der Schritt aus dem Leben tatsächlich frei verantwortet wird, bedarf es mehrerer Gespräche. Sicherheitshalber sollten diese laut Handlungsempfehlung der DEGAM zu diesem Thema nachvollziehbar dokumentiert werden. Insbesondere ist darauf zu achten, ob dem Sterbewunsch unzureichend behandelte Erkrankungen oder andere akute Notlagen zugrunde liegen. Auch Nebenwirkungen von Medikamenten, Folgen iatrogener Interventionen und Druck durch Dritte müssen ausgeschlossen werden. Im Zweifel sollte man psychiatrische Expertise nutzen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Reflexion über die eigene Haltung zur Suizidbeihilfe, um die persönliche Einstellung vom professionellen Handeln trennen zu können. Die Gespräche mit Sterbewilligen sollten mit offenem Ergebnis geführt werden. Äußerungen zur Nachvollziehbarkeit und eine Wertung oder Beurteilung des Wunsches sind zu vermeiden, betont die DEGAM.
Ärztinnen und Ärzte, die eine Suizidassistenz grundsätzlich ablehnen, teilen das am besten frühzeitig mit und bieten gleichzeitig alternative Hilfsmöglichkeiten und weitere Gespräche an. Außerdem ist zu klären, ob die Sterbewilligen eine Einbeziehung ihrer Angehörigen wünschen. Wichtig ist eine offene und wertschätzende Atmosphäre. Am besten werden mehrere Folgetermine vereinbart.
Die Äußerung eines Sterbewunschs kann Ausdruck einer akuten Suizidalität sein (s. Kasten). Deshalb ist deren Einschätzung entscheidend für das weitere Vorgehen, also ob eine sofortige Intervention (Einweisung, Unterbringung) erforderlich ist. Außerdem sind Risikofaktoren wie eine psychische Erkrankung zu erfassen.
Graduierung Suizidalität
- Stufe 1: Lebensüberdruss, Wunsch nach Ruhe und Pause
- Stufe 2: Aktive Suizidgedanken ohne konkrete Planungen
- Stufe 3: Konkrete Suizidpläne und /oder -vorbereitungen (Abschiedsbrief, Methodenerwerb, Probehandlungen)
- Stufe 4: suizidale Handlung
Im Gespräch sollen die Motive und Intentionen erfragt werden, die sich hinter der Bitte nach Suizidbeihilfe verbergen. In einer Auswertung von 118 Fällen wurden am häufigsten fehlende Lebensperspektiven bei schwerer Erkrankung genannt (29 %), es folgten Angst vor Pflegebedürftigkeit (24 %) und Lebensmüdigkeit ohne schwere Krankheit (21 %).
Mit Gesprächen über Sterbewünsche können Betroffene entlastet werden
Auch Symptome einer psychischen Erkrankung, die von den Sterbewilligen als unbehandelbar eingeschätzt wurden, gehörten dazu. Bei somatischen oder psychischen Ursachen für den Sterbewunsch soll eruiert werden, ob es kurative oder palliative Therapieoptionen gibt. Hinter der Frage nach Beihilfe zur Selbsttötung können sich auch ganz andere Wünsche verbergen. Die Bitte um Suizidassistenz ist somit kein Handlungsauftrag. Die Sorge, man könne mit Gesprächen über Sterbewünsche diese erst erwecken, ist unbegründet, im Gegenteil, sie wirken oft entlastend.
Was die Methoden betrifft, sollen Betäubungsmittel nach Anlage III BtMG nicht zum assistierten Suizid verordnet werden. Außerdem muss die Applikation bzw. Einnahme des Medikamentes durch den Sterbewilligen selbst vorgenommen werden. Dies ist wichtig für die Abgrenzung zwischen straffreier Assistenz und strafbarer Tötung auf Verlangen.
Mit dem Sterbewilligen und seinen Angehörigen sollte auch ein Vorgehen vereinbart werden, für den Fall, dass der Tod unter der gewählten Medikation nicht eintritt. Schließlich sollten die Zugehörigen frühzeitig über das notwendige Prozedere nach Eintreten des Todes informiert werden, einschließlich der obligaten Hinzuziehung der Polizei. Wichtig ist auch eine gezielte Nachbereitung für Praxisteam und Hinterbliebene.
Befinden Sie sich derzeit selbst in einer schwierigen Lage? Expert:innen können Ihnen helfen, diese Zeit zu überstehen. Hier finden Sie eine Auswahl von Anlaufstellen »