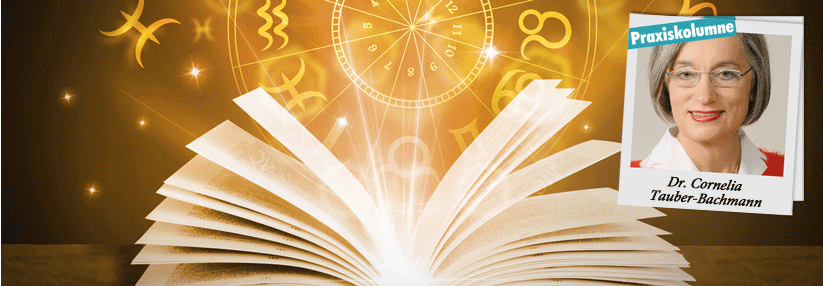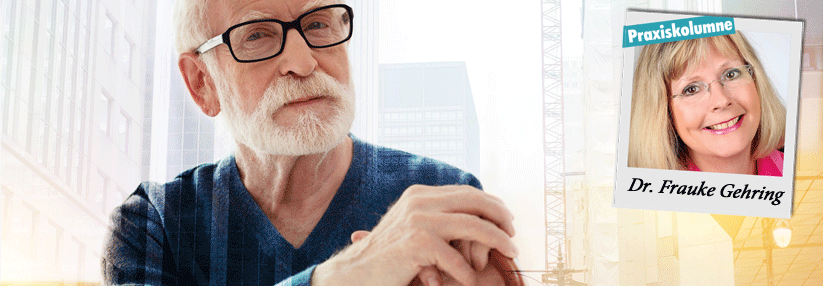Kommt ein Patient mit einem Fahrzeugbrief aus der Klinik...
 Im Abendprogramm setzt sich der Herr Professor noch mit gütigem Blick ans Patientenbett.
© fotolia/Christian Schulz
Im Abendprogramm setzt sich der Herr Professor noch mit gütigem Blick ans Patientenbett.
© fotolia/Christian Schulz
Fast täglich kommt es vor: Ein Patient betritt die Praxis, fischt mit bedeutungsschwangerem Gesicht einen oder mehrere beschriebene Zettel aus der Tasche und sagt: „Hier ist der Befund vom Facharzt. Was steht denn da drin?“ Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Der Facharzt hat die erhobenen Befunde bereits mit dem Patienten besprochen – häufig. Oder aber er hat kaum bzw. gar nicht mit ihm gesprochen – selten.
Natürlich weiß ich, dass wir Deutschen die Mentalität des Absicherns haben. Insbesondere in Zeiten täglicher Schreckensmeldungen in den Medien – Krebs allerorten! Beinahe täglich verenden Prominente! Sogar, wenn sie vorher jahrzehntelang als „Ärzte“ und „Schwestern“ in Fernsehserien erfolgreich waren. Deshalb muss man sich jeden Befund doch unbedingt noch einmal vom Hausarzt erörtern lassen. Das ist ja wohl das Mindeste! Und kostet ja nix. Außerdem hatte man beim Facharzt sowieso nur die Hälfte verstanden ...
Worüber ich mich jedoch oft wundere, ist die (noch?) selten praktizierte Nonverbalmedizin. Es gibt kardiologische Praxen, da legt die Arzthelferin das Langzeit-EKG beim „Leistungsempfänger“ an und am nächsten Tag pflückt sie es wieder ab. Selbst, wenn ich „Mit- und Weiterbehandlung“ angekreuzt habe. Falls der so Vermessene dann eine Erörterung mit dem Fachmann fürs Herz erwartet, liegt er falsch: „Das Ergebnis bespricht Ihr Hausarzt mit Ihnen“, sagt die Schwester.
Nun ist schon klar, dass hierzulande viel zu wenig Kardiologen für zu viele Alte und Herzkranke zuständig sind. Und wir Hausärzte sind ja auch für jede kollegiale Mit- und Weiterbehandlung dankbar. Aber irgendwie will es mir nicht in den Kopf, dass ein Arzt Befriedigung erfährt, indem er lediglich in einer Kemenate sitzt und Kurven auswertet. Ohne den Patienten überhaupt gesehen zu haben. So eine Art „Kardio-Mechatroniker“. Ist das unser langes Studium wert?
Ähnliches wird auch von manchen Pneumologen berichtet. Ihnen reichen die Kurven der Spirographen und die alles entscheidende Frage im Anamnesebogen: „Rauchen Sie oder haben Sie mal geraucht?“ Manchmal scheint die Annahme zu gelten: Je mehr Geräte ein Doktor zur Verfügung hat, desto weniger spricht er mit dem Patienten. Gott sei Dank ist das nicht die Regel. Außer vielleicht bei Radiologen und Laborärzten. Für ihr Dasein in Kellern oder zwischen riechenden Reagenzgläsern werden sie immerhin durch ein etwas höheres Einkommen entschädigt.
Trotzdem ist ein Trend zu beobachten: Der Patient wird immer mehr zum Objekt, das man mit modernster Technik „bearbeitet“. Das Krankenhaus wird zur „Behandlungsfabrik“. Rein – Eingriff – raus. Nur keine lange Liegezeit. Und schon gar keine großen Erklärungen. Oft kommen Patienten aus der Klinik und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was mit ihnen geschehen ist. Es hatte einfach niemand so richtig Zeit, mit ihnen ausführlich über ihre Erkrankung zu reden. Sie mussten nur für irgendetwas unterschreiben. Dabei hatten sie doch viele Dienstage vorher im Fernsehen die „Sachsenklinik“ gesehen, wo sich der Professor mit gütigem Blick ans Bette des Patienten setzt und geduldig alle Facetten der Krankheit bespricht.
Auch ich staune manchmal. Ein Entlassungsschreiben aus dem Herzzentrum liest sich wie der Fahrzeugbrief meines Autos. Technische Daten, unverständliche Abkürzungen.Dann plötzlich die Diagnose „Tako-Tsubo-Kardiomyopathie“. Noch nie gehört? Ich auch nicht. Aber es hat zum Nachforschen angeregt. Und siehe da: Eine stressbedingte Herzattacke bei Frauen über Fünfzig, die nach einer japanischen Tintenfischfalle benannt ist. Donnerwetter! Wieder was gelernt bei den Kardiologen! Find ich gut.