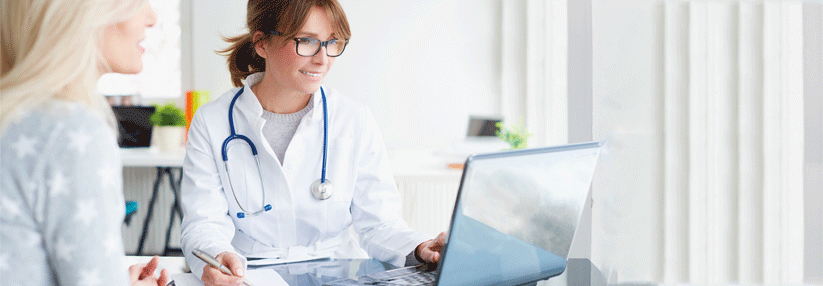Prüfung des Zusatznutzens: Frühe Nutzenbewertung neuer Arzneimittel hat sich bewährt
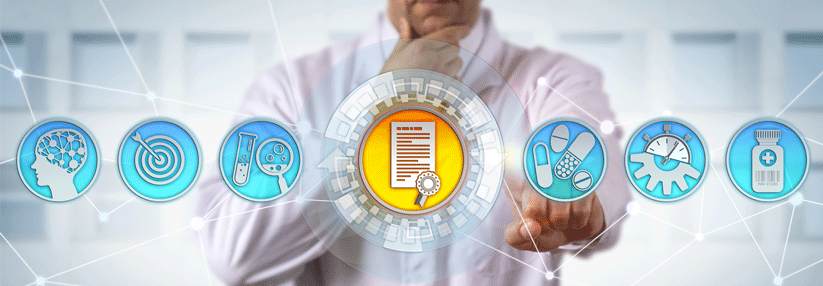 Erste Kosteneinsparungen durch die Nutzenbewertung haben sich wie erhofft eingestellt – doch es gibt noch Optimierungspotenzial.
© leowolfert – stock.adobe.com
Erste Kosteneinsparungen durch die Nutzenbewertung haben sich wie erhofft eingestellt – doch es gibt noch Optimierungspotenzial.
© leowolfert – stock.adobe.com
Professor Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ), erinnert daran, dass 2009 bei Arzneimitteln ohne Festbetrag ein Kostenanstieg von 10 % registriert worden war. Das Bundesgesundheitsministerium habe darauf mit drei Ansätzen reagiert: strukturelle Veränderungen, Abbau von Überregulierungen sowie kurzfristige Einsparungen.
Der Gemeinsame Bundesausschuss erhielt mit der Zuständigkeit für die frühe Nutzenbewertung eine neue Funktion. Die pharmazeutischen Unternehmer sind seit Januar 2011 verpflichtet, nach Markteintritt eines neuen erstattungsfähigen Medikaments dessen Zusatznutzen gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie nachzuweisen. Das BMG rechnete damals mit Einsparungen von rund 2 Mrd. Euro pro Jahr. Dieses Ziel ist laut Prof. Ludwig allerdings erstmals 2018 mit etwa 2,6 Mrd. Euro erreicht und 2019 mit 3,5 Mrd. Euro übertroffen worden.
Eine Analyse 2020 habe ergeben, dass nur in etwa 20 % der Verfahren – insgesamt 421 – gezeigt werden konnte, dass das betrachtete Arzneimittel einen erheblichen oder beträchtlichen Zusatznutzen hatte. „Eine relativ ernüchternde Zahl“, findet der Onkologe.
Bei den Umsatzbringern dominieren Onkologika
2010 seien etwa 30 Mrd. Euro für Arzneimittel ausgegeben worden, 2019 waren es 46 Mrd. Euro. Eine Kostenersparnis sei anhand dieser Zahlen nicht zu erkennen. Als Grund nennt Prof. Ludwig Entwicklungen im Arzneimittelmarkt, die weitere Anpassungen im AMNOG erforderlich machen würden.
So hätten sich 2010 unter den 30 umsatzstärksten Medikamenten zwei Onkologika befunden. 2019 waren es 13 von 37 neuen Medikamenten. „Das heißt: Die Onkologie hat sich in den letzten Jahren als eindeutig dominierendes, aber auch als sehr teures Anwendungsgebiet herausgestellt.“ Seit 2014 seien Onkologika die umsatzstärkste Arzneimittelgruppe.
Hinzu komme eine deutliche Zunahme bei seltenen Arzneimitteln. 2019 seien neun der 37 neuen Medikamente Orphan Drugs gewesen. Diese würden von Vorteilen auf europäischer Ebene und den mit der Zulassung verbundenen Anreizen profitieren.
Ein dritter Faktor sei die deutliche Zunahme an beschleunigten Zulassungsverfahren. Das führe dazu, dass die belastbare Evidenz zum Zeitpunkt der Zulassung eher dünn sei. Auch die Angaben zur Sicherheit seien gegenüber der Vergleichstherapie nicht immer überzeugend.
Dennoch: „Versorgungsverbesserungen haben wir erreicht“, sagt Prof. Ludwig. Er erwähnt die positive Resonanz auf das AMNOG bei Kollegen im Managementboard der europäischen Zulassungsbehörde EMA. „Wir werden häufig auch um dieses AMNOG beneidet.“
Kliniker hätten damit viel mehr Informationen als im europäischen Bewertungsbericht der EMA, der Erkenntnisstand sei deutlich verbessert worden. Prof. Ludwig hofft, dass sich die AMNOG-Effekte in der Versorgung durch die Implementation des Arzneimittelinformationssystems in den Arztrechnern noch steigern lassen.
Nicht erreicht worden sei allerdings eine deutliche Verbesserung der Evidenz bei der Zulassung. Das liege daran, dass häufig nicht patientenrelevante Endpunkte untersucht würden. Es seien eher weiche Endpunkte, was letztlich auch zu Schwierigkeiten in der Nutzenbewertung führe.
Probleme in den ersten AMNOG-Jahren wurden durch Lernprozesse der Akteure beseitigt, betont Professor Dr. Jürgen Wasem vom Lehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen. Doch auch er sieht noch Problematisches, auf das reagiert werden müsse.
Schon vor zehn Jahren, so erklärt er, habe er es nicht für richtig gehalten, dass Institutionen, die innerhalb des Gemeinsamen Bundesausschusses agieren, letztlich auch die Preisverhandlungen führten. An dieser Kritik hält er fest. Es gebe einen potenziellen Interessenkonflikt, wenn der GKV-Spitzenverband im Unterausschuss Arzneimittel darum kämpfe, die Rahmenbedingungen für die Nutzenbewertung so zu gestalten, dass es ihm bei der Preisfindung nützt. Das sei möglicherweise anders, wenn nicht 50 % der Stimmen im G-BA beim GKV-Spitzenverband wären.
Bei den Apps auf Rezept blieb der G-BA außen vor
Dies sei aber kein Misstrauen, betont der Ökonom, er habe den GKV-Spitzenverband als verlässlichen Verhandlungspartner kennengelernt. Aber über das Regelungssystem sei zu reden. Es müsse nicht zwangsläufig der G-BA für die Nutzenbewertung zuständig sein. So siedelte der Gesetzgeber z.B. die Beurteilung digitaler Gesundheitsanwendungen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte an.
Kritisch bewertet der Gesundheitsökonom auch die Datenlage zur Nutzenbewertung. Das zeige sich speziell bei jüngeren Entwicklungen neuartiger Therapien. Der Blick richte sich noch ausschließlich auf Daten aus Studien und Jahrestherapiekosten, „was einfach ein unzureichender Blick ist“. So fehle etwa für die Beantwortung der Frage, wie mit einer Gentherapie umzugehen sei, die 2 Mio. Euro koste, ein angemessener Referenzmaßstab. Hierzu sei das AMNOG weiterzuentwickeln.
Kongressbericht: BMC-Kongress 2021