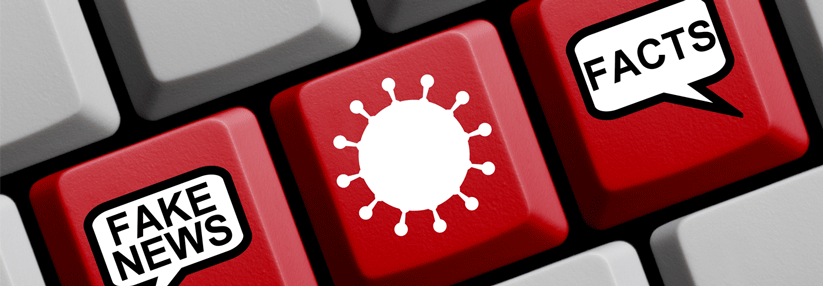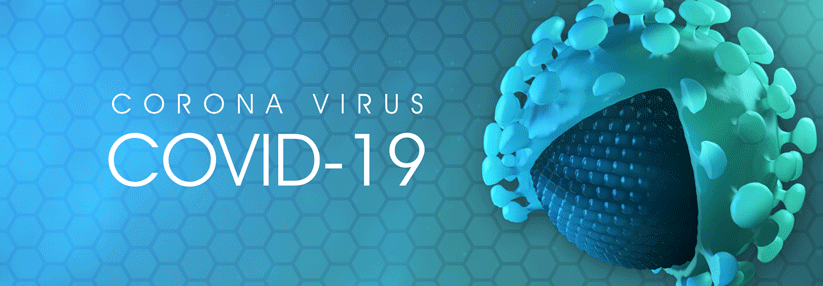
Social Distancing – epidemiologischer Ausdruck beschreibt gesellschaftliche Missstände
 Wir sind alle von der Pandemie betroffen – aber nicht gleichermaßen: Die Unterschiede in der Lebensrealität verschärfen sich.
© iStock/acilo
Wir sind alle von der Pandemie betroffen – aber nicht gleichermaßen: Die Unterschiede in der Lebensrealität verschärfen sich.
© iStock/acilo
Im März appellierte der Deutsche Schriftstellerverband PEN an Politik und Medien, den Ausdruck „soziale Distanz“ durch Begriffe wie physische Distanz oder körperlichen Abstand zu ersetzen. Soziale Distanz klinge wie ein Begriff aus dem Wörterbuch des Neoliberalismus, sagte PEN-Präsidentin Regula Venske. Dabei sei jetzt soziale Nähe, Kooperation und Verantwortung füreinander gefragt. „Man mag sagen, dass es dringlichere Probleme gibt, als Worte auf die Goldwaage zu legen. Aber Sprache prägt unser Denken und unser Verhalten“, so Venske.
Auch Dr. Roman Wittig vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig findet „Social Distancing“ wenig passend und schlägt „Spatial Distancing“ vor. „Räumlich müssen und sollten wir zwei Meter Abstand halten. Aber ,socially‘ müssten wir im Moment besonders eng sein und uns gegenseitig unterstützen, schließlich befinden wir uns aufgrund der Pandemie in einer permanenten Stresssituation“, sagt er.
Integrative Appelle trotz andauernder Stresssituation
Und, haben wir das getan, haben wir uns gegenseitig unterstützt? Wer ist überhaupt wir? Der Blick auf die Gesellschaft schien im Laufe dieses Coronajahres immer widersprüchlicher. Dabei schien das Land zunächst einen integrativeren Umgang mit der Krise gefunden zu haben als viele andere Gesellschaften. Nachbarschaftshilfe, Balkonklatschen, Solidaritätskäufe von 10er-Karten im Yoga-Studio, Vorgartensingen: Die Pandemie schien neue Züge der Gesellschaft zum Vorschein zu bringen. Ließ man sich noch vor wenigen Jahren von Werbesprüchen wie „Geiz ist geil“ und „Unterm Strich zähl ich“ locken, war mit Corona auf einmal klar, dass die Schwächeren geschützt werden müssen – sogar mit Masken, die einem selbst nur bedingt zugutekommen. Und während der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit drastischer Kriegsrhetorik seine Bürger auf den Kampf gegen Corona einschwor und Rechtspopulisten wie US-Präsident Donald Trump oder Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro an toxische Männlichkeit appellierten, sprach Kanzlerin Angela Merkel von Solidarität und ermahnte ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Gefahr ernst zu nehmen. Und traf mit diesem Ton offenbar den richtigen Nerv: Noch Anfang Juni fanden 84 % der Bevölkerung, die Kanzlerin mache ihren Job „eher gut“.
Der Historiker Frank Biess nennt das Ausmaß dieses Konsenses in einer Gesellschaft, in der zuvor noch die wachsende Fragmentierung beklagt wurde, bemerkenswert. Er sagt, das der Bundesregierung entgegengebrachte Vertrauen sei die Kehrseite der Angst vor dem Virus. Seit den 1970er Jahren werde Angst gesellschaftlich immer mehr als ein funktionales Gefühl bewertet. Und sie würde auch immer häufiger privat und öffentlich ausgedrückt. Schon die Umwelt- und Friedensbewegung der 1970er und 1980er Jahre habe auf dem Verständnis beruht, dass Angst eine konstruktive Rolle bei der Wahrnehmung gesellschaftlicher Missstände spielen kann. Die Mahnung der Kanzlerin, das Virus ernst zu nehmen, knüpft an dieses Verständnis an.
Soziale Einstellung auch von kritischer Erinnerung geprägt
Außerdem sei die Coronapandemie in Deutschland auf eine Gesellschaft getroffen, so der Historiker, für die ein vorzeitiger Tod generell unakzeptabel sei. Im Zuge des medizinischen Fortschritts und steigender Lebenserwartung, aber auch angesichts fehlender Erfahrung der jetzigen Generationen von Massentod, werde jedem einzelnen Mitglied der Gesellschaft das Recht auf ein erfülltes Leben und einen natürlichen Tod zugestanden. Die kritische Erinnerung an die NS-Zeit und die sogenannten Euthanasieprogramme ließen die Rede vom „lebensunwerten Leben“ in Deutschland mehr als anderswo als Skandal gelten. Der Konsens, dass Risikogruppen trotz hoher gesamtgesellschaftlicher Kosten zu schützen sind, scheint auch hierauf aufzubauen.
Empathie, soziale Verantwortung, ein erfülltes Leben für jedes Mitglied der Gemeinschaft – Ideale einer Gesellschaft, in der Narzissmus schon fast der Normalfall ist, gepusht von einem Wirtschaftssystem mit dem Mantra des ständigen Wachstums?
Finanzminister Olaf Scholz unterstrich gerade wieder das Gemeinsame in der Krise und twitterte, als „Coronapandemie“ zum Wort des Jahres gekürt wurde: „Es gab wohl noch nie ein ‚Wort des Jahres‘, das alle Menschen in diesem Land gleichermaßen derart betroffen hat“. Ja, wir sind alle betroffen vom Virus – aber irgendwie eben nicht gleich. Jüngere Menschen sind weniger bedroht als ältere, gesunde Menschen weniger als jene mit Erkrankungen, Menschen ohne Behinderung weniger als mit und Menschen mit Wohnung weniger als Obdachlose oder gar Menschen ohne Papiere.
Und auch jenseits der Medizin: Die Krise trifft nicht jeden gleich. Eine Familie in der Dreizimmerwohnung an der Hauptverkehrsstraße leidet unter deutlich mehr Stressfaktoren als die vierköpfige Familie im Vorstadt-Reihenhaus. Ein 450-Euro-Job ist für manche Menschen existenziell, aber viel schneller verloren als ein Lehrerposten. Schüler aus bildungsschwachen Familien und ohne technisches Equipment erleben Schulschließungen anders als Schüler aus dem Bildungsbürgertum, die gelernt haben, selbstständig am eigenen Laptop zu arbeiten. Und ob das Kurzarbeitergeld wie in der Lieblingsbranche des Landes, der Autoindustrie, auf z.B. 90 % aufgestockt wird oder eben nicht – wie so oft in jenen Berufen, wo die Löhne sowieso schon niedrig sind und überwiegend Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten – das wird bei anhaltender Krise zu einem existenziellen Unterschied. Und damit ist diese Aufzählung noch nicht vollständig.
Boni von 300 Euro oder sogar nur Gutscheine
Eine Lobby wie die Autoindustrie oder die Großen der Reisebranche hatten diese Teile der Gesellschaft noch nie. Die euphorische Anerkennung der Arbeit von Pflegenden, VerkäuferInnen und MüllfahrerInnen, deren Systemrelevanz für einen kurzen Moment in der allgemeinen Aufmerksamkeit aufblitzte, ist in nettem, aber irrelevantem Applaus und einer Bonuszahlung von 300 Euro, für VerkäuferInnen teils in Form von Gutscheinen im eigenen Laden, verpufft.
In der Sozialwissenschaft versteht man unter sozialer Distanz etwas anderes als die Kontaktvermeidung aus epidemischen Gründen. Je nach Zusammenhang kann es zwar auch um den körperlichen Abstand gehen, nämlich um jenen, den Menschen in verschiedenen Kulturen in bestimmten Gesprächssituationen jeweils für angemessen halten. In anderen Kontexten der Sozialwissenschaft beschreibt die soziale Distanz dagegen die gewünschte Nähe zu anderen Gesellschaftsmitgliedern.
Eine geringe soziale Distanz steht für das Empfinden von Gruppenzugehörigkeit bzw. gemeinsamer Identität. Man fühlt Sympathie und Verständnis füreinander. Eine große soziale Distanz führt zu Reserviertheit, oft verbunden mit diffuser Angst. Ob viel oder wenig soziale Distanz eingenommen wird, beruht auf geteilten Erfahrungen, die meist mit der Zugehörigkeit zu Schichten oder sozialen Milieus in Zusammenhang stehen.
Diese Zugehörigkeiten werden gerade weiter festgeschrieben. Die Gräben zwischen denen, die sich immer noch gut einrichten können, und denen, die sich schon vorher einrichten mussten, werden tiefer und unüberwindbarer. Und je stärker sich die Lebensrealitäten unterscheiden, desto mehr verschärfen sich die Distanzen, desto geringer wird das Verständnis füreinander.
Coronaproteste lenken ab von echten sozialen Kontroversen
Die sogenannten Coronaproteste sind dagegen aus einem ganz anderen Gesichtspunkt heraus ein soziales Problem. Auch sie schaffen tiefe Gräben in der Gesellschaft. Die Demonstrationen und Internetzusammenrottungen, die meist schon lange nichts mehr mit Corona zu tun haben, bieten einen Nährboden für menschenverachtende und autoritäre Ideologien. Deswegen braucht es Berichterstattung, öffentliche Aufmerksamkeit und Überlegungen, um sich dem entgegenzustellen. Doch über die Beschäftigung mit der Inszenierung der Wenigen und Lauten werden reale gesellschaftliche Missstände an den Rand der Wahrnehmung gedrängt.
Es ist eine Art Wortwitz: Die Umstände, unter denen der unbedacht in die Alltagssprache übernommene Begriff „Social Distancing“ zu einem Allerweltswort wurde, führen gerade zur Festschreibung alter und neuer sozialer Distanzen. Balkonklatschen ist eine schätzenswerte Geste. Aber das Recht auf ein erfülltes Leben für alle ist damit noch nicht erreicht.
Medical-Tribune-Bericht