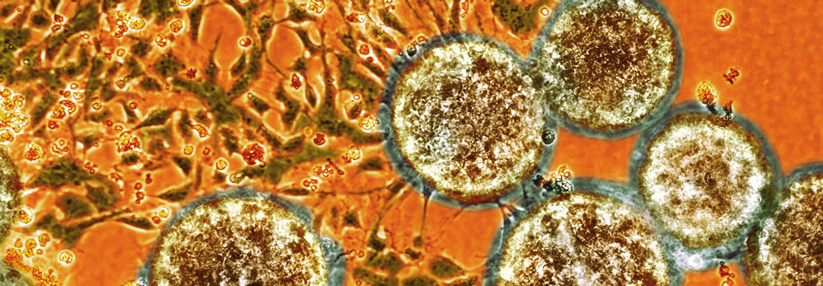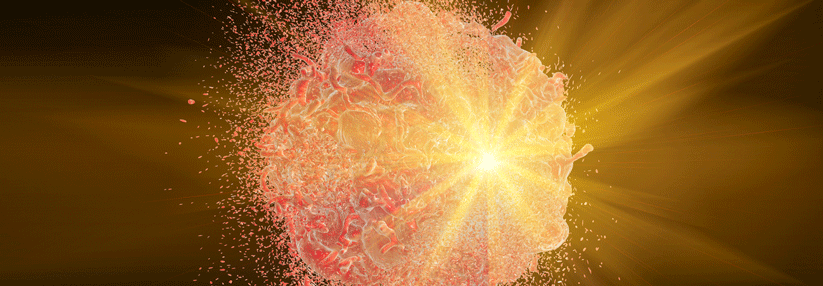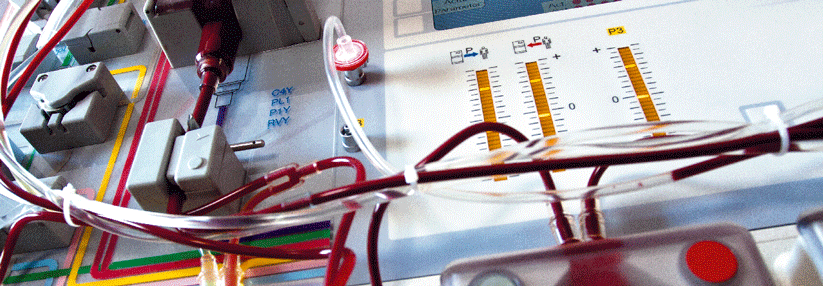
Biomarker können Aufschluss über Risiko, Schwere und Therapieansprechen geben
 Biomarker könnten GvHD, Therapieansprechen und Rezidivrisiko vorhersagen, jedoch bleibt die Implementierung schwierig.
© Nenad – stock.adobe.com
Biomarker könnten GvHD, Therapieansprechen und Rezidivrisiko vorhersagen, jedoch bleibt die Implementierung schwierig.
© Nenad – stock.adobe.com
Die NIH Consensus Group unterscheidet in Bezug auf die Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) verschiedene Biomarkersubtypen. Wie Prof. Dr. Hildegard T. Greinix, Medical University Vienna, Wien, erläuterte, dienen diagnostische Biomarker dazu, GvHD-Patient:innen zu Beginn der Erkrankung zu identifizieren. Als prädiktiv gelten Assays, die Betroffene anhand ihrer Wahrscheinlichkeit kategorisieren, dass sie auf eine bestimmte Therapie ansprechen. „Response“-Biomarker werden nach Beginn einer Behandlung gemessen und sollen einen klinischen Wirksamkeitsendpunkt ersetzen. Und anhand prognostischer Marker lassen sich Personen mit unterschiedlichen Risiken für ein Vorkommen, eine Progression oder eine Auflösung der GvHD erkennen – und zwar noch bevor die Erkrankung auftritt.
Akute GvHD
Bei der akuten GvHD hält es die Referentin für essenziell, Hochrisikopatient:innen zu identifizieren, die von einer intensivierten Immunsuppression profitieren. Denn diese kann potenziell eine schwere GvHD verhindern. Niedrigrisikoerkrankte wiederum könnten möglicherweise eine reduzierte Prophylaxe erhalten.
Ein geeigneter Biomarker scheint REG3α*, dessen Plasmaspiegel bei Personen mit beginnender gastrointestinaler GvHD dreifach erhöht waren. Ein Score, der neben REG3α auch TNFR1 und ST2 umfasste, gab Aufschluss über verschiedene klinische Endpunkte: Ein Ann-Arbor-GvHD-Score von 3 Punkten war gegenüber 1–2 Punkten mit einer erhöhten nicht-rezidivbedingten Mortalität (NRM) und einem kürzeren OS assoziiert. Ein Score von 3 indizierte ebenfalls ein geringeres Ansprechen auf eine primäre Therapie (46 % vs. 86 % bei einem Score von 1).
Die zusätzliche Gabe des monoklonalen Antikörpers Natalizumab führte bei neu diagnostizierter aGvHD (Ann-Arbor-Stadium 2/3) nicht zu besseren Ansprechraten als eine alleinige Kortikosteroidtherapie. Auch NRM- und OS-Rate verbesserten sich nicht. In einer anderen Studie fokussierten sich Forschende auf eine Niedrigrisiko-Gruppe (Minnesota Standardrisiko + Ann Arbor 1). Die Teilnehmenden erhielten entweder eine Itacitinib-Monotherapie oder Steroide. Diejenigen im Prüfarm sprachen wahrscheinlicher zum siebten Tag auf die Therapie an als die der Kontrolle (81 % vs. 66 %; p = 0,02). Mit Itacitinib Behandelte bekamen zudem 90 % weniger systemische Steroide innerhalb des ersten Monats.
Wissenschaftler:innen identifizierten darüber hinaus ein Urinproteomprofil (aGvHD_MS17) 14 Tage vor dem Auftreten einer aGvHD. 92 Patient:innen erhielten randomisiert und nach dem Proteomprofil selektiert entweder Prednisolon oder Placebo für fünf Tage, gefolgt von einem Ausschleichen der Behandlung. Es ergab sich ein tendenzieller, aber nicht-signifikanter Unterschied in Bezug auf Inzidenz und Schwere einer aGvHD (HR 1,69; p = 0,27). Die Rezidivrate unterschied sich zwischen Prednisolon- und Placebogabe ebenfalls nicht signifikant (14,0 % vs. 20,2 %; p = 0,46).
Plasmabiomarker für die akute GvHD seien nicht-invasiv, objektiv und kostengünstig, fasste Prof. Greinix zusammen. REG3α und ST2 deuten dabei auf einen Gewebeschaden im Gastrointestinaltrakt hin. REG3α gelte als validierter Marker für eine GI-GvHD, ebenso wie für das Therapieansprechen, die NRM und das OS. Auch gebe es bereits einen Algorithmus für die aGvHD; was noch fehle, sei eine präemptive oder frühe Behandlung für Hochrisikopatient:innen. Positive Ergebnisse liegen hingegen für Erkrankte mit niedrigem Risiko vor, die Itacitinib erhielten.
Implementierung in die Klinik – eine Herausforderung
Probleme bei der Implementierung von Biomarkern in die klinische Praxis umfassen:
- Es braucht klinische Daten mit hoher Qualität, die aus Post-Transplant-Besuchen generiert werden.
- Unterscheidung zwischen einer aktiven cGvHD und einer kumulativen Organschädigung durch eine chronische GvHD.
- Der Einfluss von u. a. einer vorangegangenen akuten GvHD und Infektionen.
- Die Kosten großer Biomarkerstudien liegen hoch.
- Es gibt kein umfassendes Biorepositorium für cGvHD-Proben.
Chronische GvHD
Die vielversprechendsten Biomarker für die chronische GvHD umfassen laut einem systematischen Review mit 91 Studien die löslichen Faktoren CXCL10, BAFF, IL-15, CD163, DKK3 sowie ein Panel aus ST2, CXCL9, MMP3 und OPN. Zelluläre Marker waren CXCR3+/CD56bright NK-Zellen und CD19+/CD21low B-Lymphozyten. Als Beispiel griff Prof. Greinix höhere Plasmakonzentrationen von CD163 heraus, die mit einer späteren de-novo-cGvHD einhergingen.
Verschiedene prognostische Biomarker wurden in einer multizentrischen Phase-3-Studie geprüft. Die Teilnehmenden erhielten nach einer allogenen Stammzelltransplantation eine GvHD-Prophylaxe mit entweder Tacrolimus/Sirolimus oder Tacrolimus/Methotrexat. Erhöhte Plasmakonzentrationen von ST2 und TIM3 an Tag 28 nach der Transplantation korrelierten in einer multivariaten Analyse mit der Zwei-Jahres-NRM. Erhöhungen der beiden Biomarker waren zudem mit dem OS assoziiert. CXCL9-Werte über dem Median an Tag 100 oder später gingen wiederum mit einer späteren chronischen GvHD einher.
Ein Biomarkerprofil aus CXCL9, MMP3 und DKK3 kann ebenfalls Aufschluss über die Entwicklung einer cGvHD nach einer Stammzelltransplantation geben. Diejenigen mit einem als „high“ bezeichneten Profil an Tag 90 oder später entwickelten die Komplikation signifikant häufiger als Personen mit einem „Low“-Profil.
Forschende stellten im Rahmen des „NIH Consensus Development Project“ einen vierteiligen Rahmen zur Implementierung von Biomarkern in die klinische Praxis bereit. Das bleibe aber noch immer herausfordernd, betonte die Referentin (s. Kasten). Bisher haben sich noch keine Biomarker für die klinische Anwendung bei der chronischen GvHD qualifiziert, allerdings wurden bereits mehrere von ihnen in Studien bestätigt – sowohl in Test- als auch in Validierungskohorten. Ein validierter Risikobiomarkeralgorithmus für die cGvHD fehlt bisher ebenfalls.
* Regenerating Islet-Derived 3-alpha
Quelle:
Greinix HT; EBMT Annual Meeting 2025; Vortrag „E03-2 – Challenges and opportunities of biomarkers in GVHD“
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).