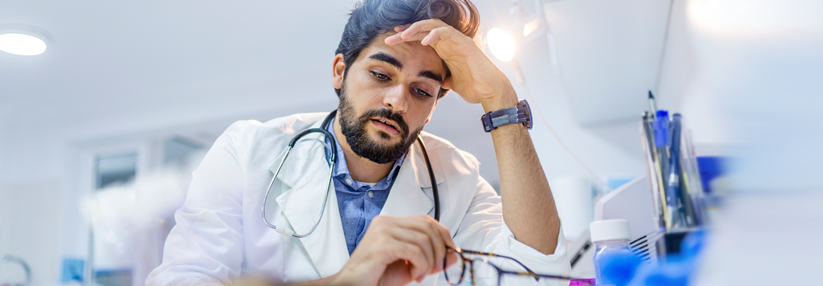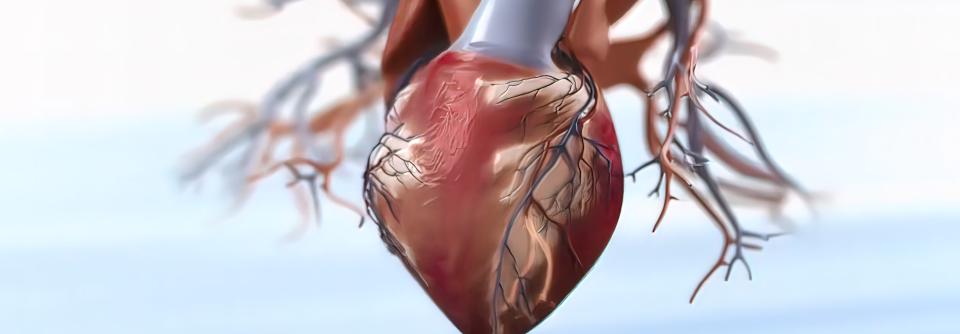
Cartoon Gesundheitspolitik
Ein frischgebackener Arzt und eine erfahrene Oberärztin sprechen über die Schwierigkeiten des Berufsstarts
 Mit der Verantwortung steigt die Angst, etwas Wichtiges zu übersehen.
© BillionPhotos.com - stock.adobe.com
Mit der Verantwortung steigt die Angst, etwas Wichtiges zu übersehen.
© BillionPhotos.com - stock.adobe.com
Als „anstrengend und herausfordernd“ beschreibt Alexander Laspoulas seine ersten Weiterbildungswochen. Er ist Assistenzarzt für Innere Medizin an einer Uniklinik und steht kurz vor dem Ende des ersten Jahres. Er ist guter Dinge und konnte leicht einsteigen. Der Übergang vom Praktischen Jahr in die Weiterbildung war dennoch kein Schritt, sondern ein Sprung. „Grundsätzlich wird von einem verlangt, mehr und mehr zu entscheiden – und man hat auch das Bedürfnis, zu entscheiden, um besser zu werden und als Arzt oder Ärztin weiterzukommen.“
Schrotschuss-Diagnostik und Angst vorm Anrufen
Besonders überfordernd kann die Rotation auf der Notaufnahme sein: Die große Zahl der Patientinnen und Patienten, die gleichzeitig eintreffen und priorisiert werden müssen, die Komplexität der Fälle, die geforderte Schnelligkeit und schwierige Therapieentscheidungen, etwa am Lebensende. „Die Angst vor Fehlern schwingt oft mit“, beobachtet Susanne Heinze bei ihren Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung „Klinische Akut- und Notfallmedizin“ und arbeitet als Oberärztin in einer zentralen Notaufnahme.
Sie kann sich noch gut daran erinnern, dass auch sie anfangs Angst hatte, etwas zu übersehen. Sie habe dann die Tendenz gehabt, „Schrotschuss-Diagnostik“ zu betreiben, erzählt sie schmunzelnd. Heute ist sie es, die nachts von verunsicherten Assistenzärztinnen und -ärzten angerufen wird. Sie weiß, dass die Hemmschwelle, bei Vorgesetzten nachzufragen, durchaus groß sein kann. Aber ihr Motto laute „Lieber einmal zu viel als zu wenig“, erklärt sie. „Dafür ist der Hintergrund da und so bin ich selbst auch groß geworden.“ Um solche Fälle standardisierter anzugehen, versucht ihre Klinik derzeit, Indikatoren zu definieren, bei denen immer unbedingt Vorgesetzte angerufen werden sollten.
Bei manchen Fragen müssen es hingegen nicht unbedingt Oberärztin oder Oberarzt sein, die Rat geben. Laspoulas empfiehlt, auch auf gleicher Hierarchieebene um Hilfe zu bitten. „Vor allem die anderen assistenzärztlichen Kollegen sind super Ansprechpartner, weil die Schwelle niedrig ist. Das war auch einer der Tipps vor meinen ersten Nachtdiensten an mich, dass wir Intensiv- und Überwachungsstationen im Haus haben und es Gold wert ist, mit der Symptom- oder Befundkonstellation zu erfahrenen Assistenten zu gehen und nachzufragen.“ Auch Pflegekräfte hätten oft ein gutes Gespür für die Dringlichkeit der Situation, ergänzt Heinze.
Natürlich gerät man in den ersten Wochen des Dienstes auch mal in berufliche Konflikte, insbesondere wenn es um den Dienstplan geht. Streitigkeiten entstünden aber meist nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Stress, betont Heinze. Beim fünften Anruf innerhalb weniger Minuten sei der Ton auch mal schärfer. Wichtig sei dann, solche Situationen nachzubesprechen, sich zu entschuldigen – und daran zu erinnern, dass das Gegenüber keine Schuld trifft. Auch Laspoulas plädiert für Geduld, mit anderen, aber auch mit sich selbst.
In der Weiterbildung kann man auch schlechte Erfahrungen machen. Heinze berichtet in der Podcastfolge von einem Moment, der sich bei ihr eingebrannt hat: In einem Aufklärungsgespräch kommunizierte sie indirekt eine schlechte Prognose, die der Patient noch nicht kannte. Die Reaktion: „Sie haben Ihren Beruf verfehlt.“ Heute weiß sie, dass junge Kolleginnen und Kollegen in solchen Momenten Supervision brauchen. Strukturen gegen das Second-Victim-Phänomen gibt es in ihrer Klinik mittlerweile – noch nicht überall eine Selbstverständlichkeit, aber ein wichtiges Signal.
Kompetente Begleitung verbessert die Ausbildung
Wichtig sei es auch, die Weiterbildung strukturiert zu begleiten, betont die Oberärztin. In ihrer Klinik gibt es regelmäßige Mentoring-Gespräche während der Rotationen. So könne individuell besser eingeschätzt werden, ob jemand beispielsweise schon genug kardiologische oder gastroenterologische Fälle gesehen hat – oder gezielt noch in bestimmten Bereichen gestärkt werden sollte. „Ich sehe es als meine Aufgabe, den Ausbildungsstand zu kennen und zu wissen, was ich schon erwarten kann und was nicht.“ Ein solches Begleitmodell könne helfen, Überforderung frühzeitig zu erkennen und Resilienz gezielt zu fördern.
Die hohe Arbeitsbelastung in der Anfangszeit bringt viele an ihre Grenzen. Laspoulas berichtet, dass er Hobbys aufgeben musste, um mit den wechselnden Diensten klarzukommen. Im Laufe der Zeit hat er jedoch Wege gefunden, auf einen guten privaten Ausgleich zur Arbeit zu achten. Welche das sind, und welche zentralen Tipps er und Heinze gerne vor ihrem Berufsstart bekommen hätten, hören Sie in der Podcastfolge.
Mehr zum O-Ton Innere Medizin
O-Ton Innere Medizin ist der Podcast für Internist:innen. So vielfältig wie das Fach sind auch die Inhalte. Die Episoden erscheinen alle 14 Tage donnerstags auf den gängigen Podcast-Plattformen.
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).