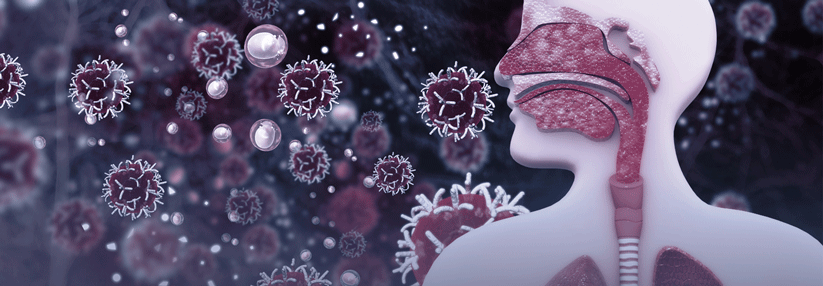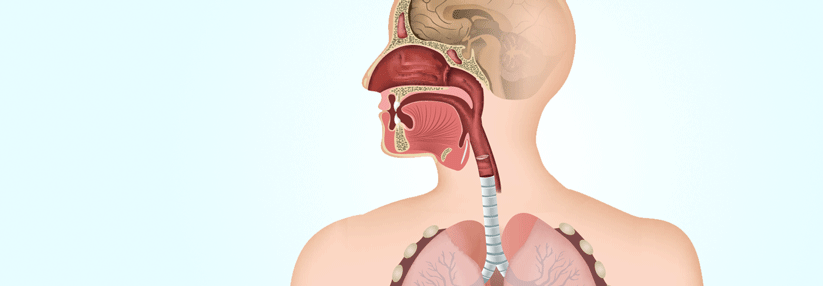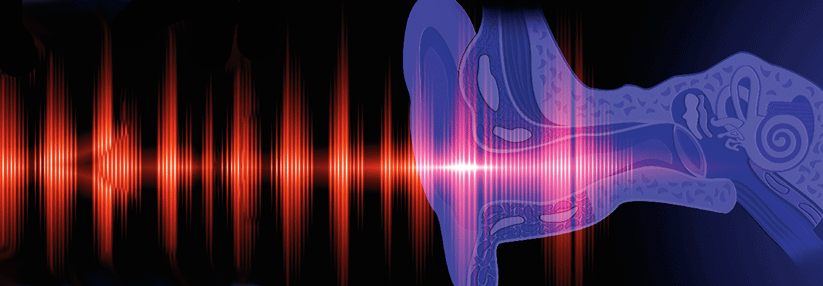
Lohnt sich eine CPI-Erhaltung?
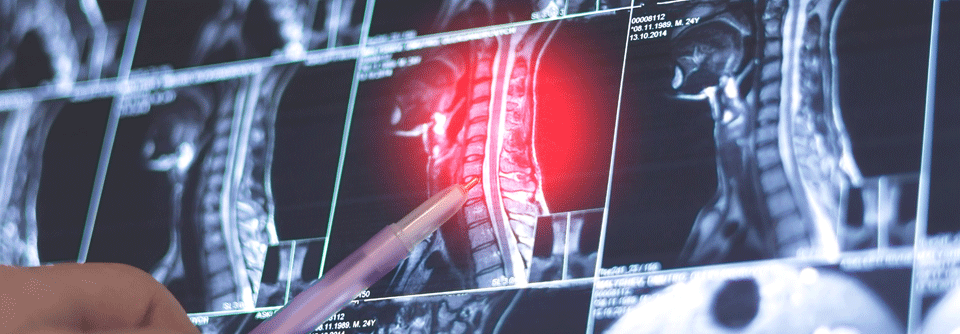 Eine Immuntherapie nach Chemoradiotherapie zeigt bei Nasopharynxkarzinomen positive Effekte, bei HNSCC jedoch nicht.
© Vadym – stock.adobe.com
Eine Immuntherapie nach Chemoradiotherapie zeigt bei Nasopharynxkarzinomen positive Effekte, bei HNSCC jedoch nicht.
© Vadym – stock.adobe.com
Etwa die Hälfte der Erkrankten mit lokal fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinomen der Kopf-Hals-Region (HNSCC) und 20–30 % derjenigen mit lokal fortgeschrittenem Nasopharynxkarzinom (NPC) erleiden nach kurativ intendierter Therapie ein Rezidiv. Da beide Entitäten in der rekurrenten oder metastasierten Situation auf eine Checkpointblockade ansprechen, erprobten Forschende nun in zwei Studien eine immuntherapeutische Erhaltung.
Die Phase-3-Studie IMvoke010 schloss 406 Personen mit einem lokal fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinom der Kopf-Hals-Region und hohem Risiko (s. Kasten) ein.1 Wie die Autor:innen um Prof. Dr. Robert I. Haddad, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, schildern, erhielten diese nach definitiver multimodaler Therapie entweder 1.200 mg Atezolizumab oder Placebo dreiwöchentlich für bis zu einem Jahr.
Die Erhaltung führte nicht zu einer signifikanten Verlängerung des medianen ereignisfreien Überlebens (59,5 Monate vs. 52,7 Monate in der Kontrolle; HR 0,94; 95%-KI 0,70–1,26; p = 0,68). Auch bei der geschätzten Überlebensrate nach zwei Jahren zeichnete sich kein Unterschied ab (82,0 % vs. 79,2 %). Neue Sicherheitssignale und unerwartete Toxizitäten traten ebenfalls nicht auf.
Ein besseres Ergebnis erzielte eine Checkpointinhibition gegen lokal fortgeschrittene Nasopharynxkarzinome, wie Dr. Ye-Lin Liang, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, und Kolleg:innen berichten.2 An der DIPPER-Studie hatten 450 NPC-Patient:innen mit lokal fortgeschrittenen Malignomen (T4, N1, M0 oder T1–4, N2–3, M0) teilgenommen. Sie bekamen im Anschluss an eine Chemoradiotherapie entweder Camrelizumab (200 mg dreiwöchentlich für zwölf Zyklen) oder wurden ausschließlich nachbeobachtet.
Nach drei Jahren waren noch 86,9 % der Immuntherapiegruppe gegenüber 77,3 % des Vergleichsarms ohne Fernmetastasen oder Lokalrezidiv am Leben (HR EFS 0,56; 95%-KI 0,36–0,89; p = 0,01). 23 Personen (11,2 %) gegenüber 7 Teilnehmenden (3,2 %) entwickelten unerwünschte Ereignisse vom Grad 3 oder 4. Camrelizumab führte bei über 85 % der Behandelten zu einer reaktiven Proliferation des Kapillarendothels, die aber nur selten Grad 2 überschritt. Insgesamt beeinträchtigte die Gabe des PD1-Inhibitors die Lebensqualität der Erkrankten aber nicht.
Wer nahm an IMvoke010 teil?
Die Patient:innen litten an einem Plattenepithelkarzinom der Kopf-Hals-Region im Stadium IVa/b (Mundhöhle, Larynx oder Hypopharynx), einem HPV-negativen Oropharynxkarzinom oder einem HPV-positiven Oropharynxkarzinom im Stadium III. Alle hatten eine multimodale Therapie erhalten und dadurch eine CR (84,2 %), ein partielles Ansprechen oder eine Krankheitsstabilisierung erreicht.
Diskrepanz in Immuntherapie
Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären? Prof. Dr. Marshall Posner, Cancer Center of South Florida, Palm Springs, merkte an, dass entitätsspezifische Unterschiede in der Wirksamkeit einzelner Immuntherapeutika bisher mangelhaft untersucht seien.3 Insbesondere gebe es keine Evidenz dafür, dass PD-L1-Inhibitoren wie Atezolizumab PD1-Hemmern bei Kopf-Hals-Tumoren ebenbürtig seien. In der chinesischen Studie nutzten die Forschenden wiederum einen PD1-Antikörper.
Zudem könne es sich nachteilig auswirken, eine Checkpointinhibition erst im Anschluss an die definitive Therapie mit Beseitigung von Primarius und Lymphknoten durchzuführen. Dies gelte besonders nach immunsuppressiven Behandlungen wie Bestrahlungen. Nasopharynxkarzinome werden allerdings durch Epstein-Barr-Viren (EBV) ausgelöst, die fast alle Erwachsenen latent in sich tragen. Dr. Posner gibt zu bedenken, dass sich eine vorexistierende Immunantwort gegen EBV eventuell auch dann rekrutieren lasse, wenn die Radiotherapie die Immunzellen in der Tumormikroumgebung abgetötet hat.
Der Kollege wünscht sich mehr Studien im kurativen Erstliniensetting, in der CPI allein oder eine Chemoimmuntherapie vor der Chemoradiotherapie geprüft werden. Beide Ansätze erreichten beim Nasopharynxkarzinom schon erste Erfolge. Bezüglich HNSCC seien vergleichbare Untersuchungen jedoch überfällig, obwohl Chemoimmuntherapien in der rekurrenten und metastasierten Situation das Outcome verbessern.
Quellen:
1. Haddad R et al. JAMA 2025; DOI: 10.1001/jama.2025.1483
2. Liang YL et al. JAMA 2025; DOI: 10.1001/jama.2025.1132
3. Posner M. JAMA 2025; DOI: 10.1001/jama.2025.3012
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).