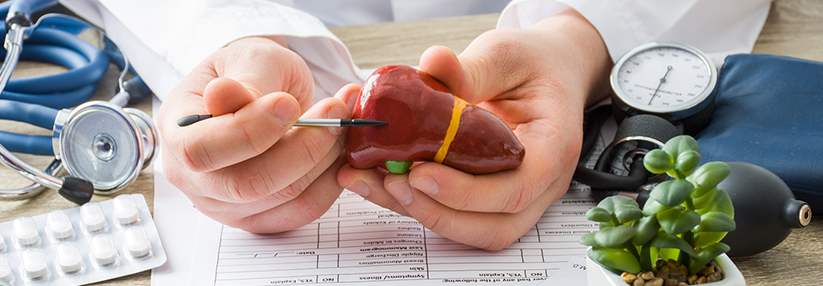
Neue Entwicklungen bei seltenen Lebererkrankungen
Die Autoimmunhepatitis, die primär biliäre Cholangitis und die primär sklerosierende Cholangitis werden zwar den seltenen Lebererkrankungen zugeordnet. Doch es lohnt sich, die wichtigsten Entwicklungen im Hinblick auf die drei Entitäten zu kennen.
Die primär biliäre Cholangitis (PBC) ist unter den seltenen Lebererkrankungen die häufigste. Lange Zeit war Obeticholsäure (OCA) die einzige für diese Indikation zugelassene Therapieoption. Die Substanz hat im Jahr 2024 allerdings ihre Zulassung verloren, erläuterte Dr. Johannes Hartl vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Das sei laut seiner Einschätzung für die meisten Kolleginnen und Kollegen aber wahrscheinlich gar nicht so tragisch, denn meist werde sowieso Bezafibrat (off label) verwendet. Dies sei eine effektive Zweitlinientherapie. Als weitere Optionen stehen seit 2024 die PPAR*-Agonisten Elafibranor und Seladelpar zur Verfügung. Head-to-Head-Studien gibt es für die Substanzen zwar noch nicht, im Vergleich der Einzelstudien erzielt Bezafibrat allerdings bessere Ergebnisse als die beiden neueren Optionen. Welche Therapie sich auf lange Sicht bewährt, wird sich zeigen.
Fatigue und Pruritus sind zentrale Begleitsymptome
Bei der Betreuung der betroffenen Patientinnen und Patienten sollte man eines der zentralen Begleitsymptome cholestatischer Erkrankungen nicht vergessen: die Fatigue. Sie sei „der größte unmet clinical need“ bei der PBC sowie bei der primär sklerosierenden Cholangitis (PSC), so Dr. Hartl. Von Fatigue betroffen sind Studien zufolge 29 % der PBC- und 19 % der PSC-Patientinnen und -Patienten. Während das Symptom im Rahmen einer PBC vor allem bei Frauen auftritt, gibt es bei der PSC auch zahlreiche Männer, die darunter leiden. Mit dem Krankheitsstadium korreliert die Fatigue bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. Gegen ein weiteres für PBC- und PSC-Betroffene sehr belastendes Symptom, den Pruritus, scheint Bezafibrat bisher ebenfalls am besten zu wirken. Es wird derzeit als Erstlinientherapie des Juckreizes bei PSC betrachtet.
Wichtig bei Patientinnen und Patienten mit PSC ist es insbesondere, das erhöhte Karzinomrisiko im Blick zu haben. Vor allem die Wahrscheinlichkeit, ein Cholangiokarzinom zu entwickeln, ist bei dieser Erkrankung hoch, das Lebenszeitrisiko liegt zwischen 6 und 20 %. Doch auch Gallenblasen-, hepatozelluläre und Kolorektalkarzinome kommen bei Betroffenen häufiger vor. Ein regelmäßiges Screening, z. B. mittels MRT, ist daher unerlässlich. Studien zeigen jedoch zumindest für das Cholangiokarzinom, dass dieses trotz der Vorsorgemaßnahmen meist nicht rechtzeitig erkannt wird. Das sei auch in der Klinik so, bestätigte Dr. Hartl. Tritt eine PSC zusammen im Rahmen einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung auf, seien jährliche Koloskopien indiziert. Denn CED-Erkrankte, bei denen zusätzlich eine PSC besteht, entwickeln im Schnitt deutlich früher ein Karzinom als reine CED-Patientinnen und -Patienten (39 vs. 59 Jahre).
Schlechte Remissionsraten bei der Autoimmunhepatitis
Das primäre Therapieziel bei der Autoimmunhepatitis (AIH) ist die komplette biochemische Remission. Multizentrische, prospektive Registerdaten zeigen aber, dass diese bislang noch zu selten erreicht wird. Die Remissionsrate nach einem Jahr liegt demnach bei gerade mal 63 % unter der derzeitigen Standardtherapie, eine steroidfreie Remission erreichen 27 % der Patientinnen und Patienten. Im Hinblick auf die Therapieoptionen gab es „wenig Innovation die letzten 15 bis 20 Jahre“, bedauerte Dr. Hartl. „Da ist viel Luft nach oben.“
Zur Remissionsinduktion wird nach wie vor Prednisolon eingesetzt. Dieses ist Budesonid im Direktvergleich deutlich überlegen. So erreichten in einer Studie mit insgesamt 381 Patientinnen und Patienten 72 % unter Prednisolon eine biochemische Remission im Vergleich zu 49 % unter Budesonid. Alternativen zum Glukokortikoid gibt es bislang nicht. In einer Proof-of-Principle-Studie wurde Infliximab in der Induktionstherapie getestet. Erste Ergebnisse werden demnächst erwartet. In der Drittlinientherapie habe es sich bereits bewährt, so der Experte.
Für den Remissionserhalt ist Azathioprin (AZA) der bislang unangefochtene Standard seit etwa 50 Jahren. Als Alternative kann man Mycophenolat-Mofetil erwägen. Die Substanz ist zwar im Allgemeinen besser verträglich als AZA. Da aber auch Frauen im gebärfähigen Alter an einer AIH erkranken, sei es unbedingt wichtig, die Teratogenität auf dem Schirm zu haben, mahnte der Referent. Eine weitere Option statt Azathioprin ist laut Dr. Hartl 6-Mercaptopurin. Da es sich dabei um einen aktiven Metaboliten von AZA handelt, zeige es dieselbe Wirkung, sei aber in der Regel verträglicher.
In einem neuen Therapiealgorithmus für die AIH sollen zukünftig auch die Metabolite von AZA berücksichtigt werden. Wenn unter keinem der Wirkstoffe eine Remission erreicht wird, sollte man den 6TGN**-Spiegel prüfen. Dieser entscheidet dann über die weitere Therapie.
Quelle: Kongressbericht 19. Jahrestagung der GGHBB (Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie in Berlin und Brandenburg)
*peroxisomal proliferator-activated receptor gamma
**6-Thioguanin-Nukleotid
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).



