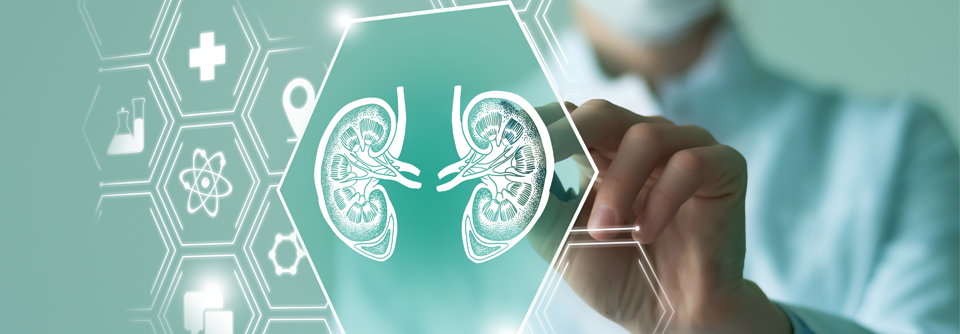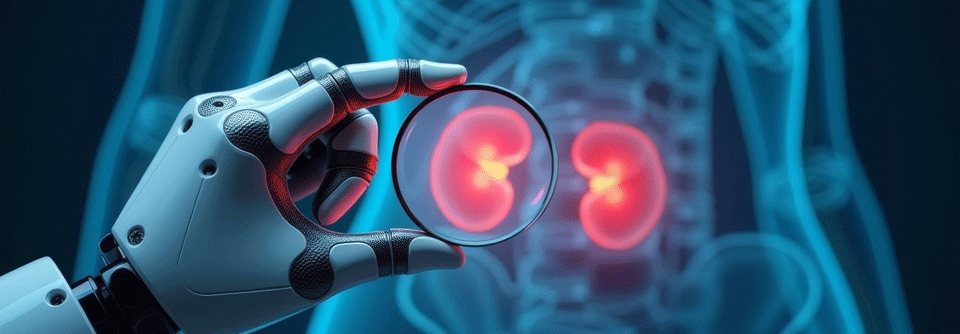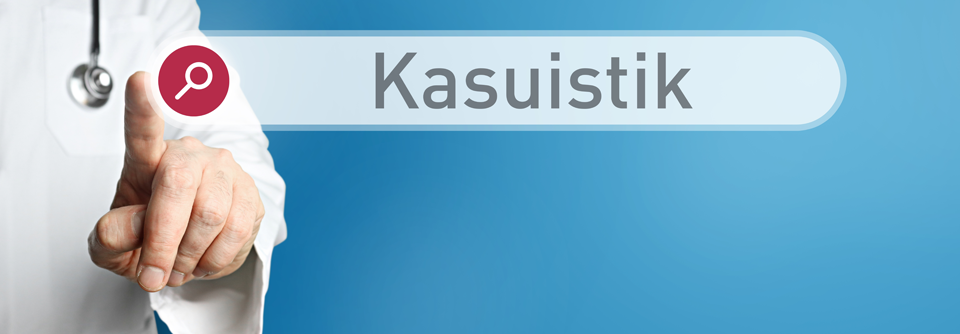
Nierenkrankheit: Auf der Suche nach Entzündungsmarkern
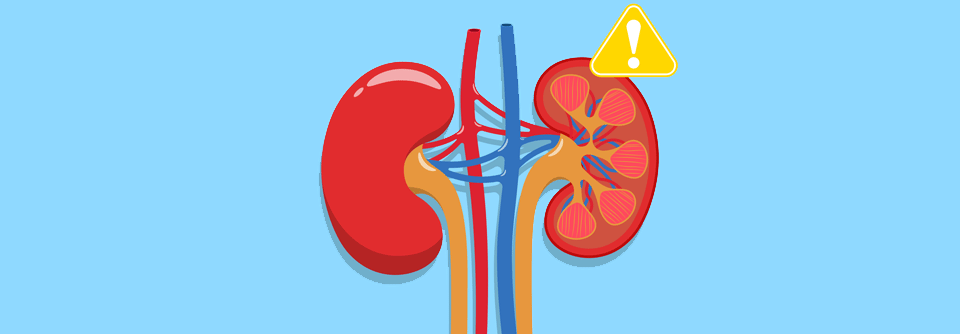 Wie entsteht eine Nierenkrankheit? Wie verläuft der Übergang von gesund zu krank? Dies und mehr untersucht PD Dr. Nicola Wielck
© antoniofrancois - stock.adobe.com
Wie entsteht eine Nierenkrankheit? Wie verläuft der Übergang von gesund zu krank? Dies und mehr untersucht PD Dr. Nicola Wielck
© antoniofrancois - stock.adobe.com
IMMEDIATE ist ein EU-Projekt zur Früherkennung von Krankheiten bzw. deren entzündlicher Vorboten. Was genau ist das Projektziel?
Wir sind ein großes Konsortium an Forschenden, das Klinker:innen aus verschiedenen Krankheitsrichtungen vereint und erstmals krankheitsübergreifende Pathomechanismen, also die Abläufe von Krankheitsprozessen, untersucht. Dabei geht es vor allem um den Übergang von Gesundheit zu Krankheit. Aber wie definiert man das? Für die beteiligten Forschenden ist klar: Die Früherkennung von der Gesundheit hin zum krankhaften Status ist sehr wichtig für präventive Maßnahmen.
Die chronische Inflammation gilt als frühes Zeichen für Erkrankungen. Wie lassen sich diese Entzündungsprozesse konkret feststellen?
Bevor ein Organschaden beispielsweise an der Niere entsteht, können wir systemisch Marker der Entzündung, der chronischen Inflammation feststellen. Wir konzentrieren uns in diesem Konsortium auf die sog. Mikrobiom-Immunachse. Denn auch aus dem Mikrobiom – es beeinflusst u.a. das Immunsystem – kommen Botenstoffe, sog. Metabolite, die zum Teil protektiv, aber auch proinflammatorisch wirken können. Jede Krankheit hat einen eigenen Pathomechanismus, aber wir gehen davon aus, dass es Parallelen in der frühen Entzündungsphase, in diesem Übergang von gesund zu krank gibt. Es gilt, diese Gemeinsamkeiten bei unterschiedlichen Erkrankungen wie Nierenerkrankungen, Diabetes und Mutiple Sklerose herauszufinden.
In welchen Bereichen und Ländern wirken die Forschenden?
Die Forschenden aus Deutschland kommen von der Charité und dem Max Delbrück Center am Standort Berlin. Weitere Standorte sind in Erlangen und Essen mit Prof. Dr. Mario Schiffer und Prof. Dr. Lars Pape. Auch das Imperial College London ist dabei. Zudem arbeiten polnische Wissenschaftler:innen mit uns sowie belgische Biotech-und ein IT-Unternehmen aus Italien und die Kolleg:innen aus Israel vom Weizman Institut of Science. Es ist eine interessante Kombination aus Gundlagenwissenschaftler:innen, aus Kliniker:innen, aus Vertreter:innen der Industrie und der IT. Die Bereiche wurden gut zusammengefasst, was nicht einfach ist: Es ist ein Riesenprojekt.
Wie funktioniert diese internationale Zusammenarbeit zur Erforschung all dieser Mechanismen, die diese schweren Entzündungen im Körper auslösen – zum Beispiel in der Niere?
In Bezug auf die Niere geht es bei IMMEDIATE um das Thema Transplantation und um die Gesundheits-Krankheitstransition, also den beschriebenen Übergang von gesund zu krank. Ich bin einer der Initiatoren dieses Konsortiums und habe dafür plädiert, die Niere bzw. die Transplantation mit aufzunehmen. Das wurde eingangs abgelehnt, weil es hieß: Nierentransplantierte sind ja schon vorerkrankt, hatten schon eine Niereninsuffizienz, und haben jetzt zwar eine neue Niere, sind aber per se krank. Wir aber haben gesagt: Dies ist sozusagen unsere neue Baseline, die wir erschaffen. Das ist ein Start in ein neues, gesünderes Leben. Es ist zunächst ein funktionierendes Nierentransplantat und wir als Kliniker:innen müssen dafür kämpfen, Veränderungen an diesem Status früh zu erkennen. Der Organverlust ist sozusagen dann der Rückfall in die Krankheit
Bei einer Autoimmunerkrankung hat man beispielsweise ein stabiles Niveau und man versucht, das Wiederaufflammen der Erkrankung früh zu erkennen.
Bei der Nierentransplantation ist das ein bisschen schwieriger zu definieren. Es handelt sich um ehemalige Dialysepatient:innen, die jetzt ein neues Organ und einen Neustart in die Gesundheit, in die gesunde Nierenfunktion erhalten. Dafür haben wir als Nephrolog:innen gekämpft und versucht, in diesem Projektantrag gut darzustellen, warum wir glauben, dass diese Patientenkohorte in diesem Konsortium einen festen Platz hat und nicht vergessen werden sollte.
Medikamente wie Immunsuppressiva, die Nierentransplantierte einnehmen müssen, spielten da keine Rolle?
Wie gesagt: Es geht um die Neudefinition von Gesundheit. Wir wollen diesen Zustand erhalten und die Abstoßung bzw. den Organverlust anderer Ursachen früh erkennen. Natürlich ist es so, dass die Immunsuppression diesen Organerhalt unterstützt bzw. erst möglich macht.
Man muss sich das so vorstellen: Wir produzieren Daten mit sog. Omics-Methoden. Dabei bestimmen wir zahlreiche Parameter mit einer Messung in einem speziellen Verfahren, genauer Metabolite, also kleine, niedermolekulare Stoffe, die im Körper zirkulieren. Metabolite können, wie schon erwähnt, aus dem Mikrobiom kommen. Wenn man viele davon in einer Messung erfassen kann, nennt sich das Metabolomics. Diese Daten setzen wir in den Kontext mit dem, was wir noch über die Patient:innen wissen, sprich ihre Medikamente, ihre Ernährung und ihre Komorbiditäten, also ihre Begleit- oder Folgeerkrankungen.
Das dürften unglaublich viele Daten sein…
Richtig. Meine statistischen oder biostatistischen Fähigkeiten reichen nicht aus, um das alles miteinander in den Kontext zu setzen und statistisch genau und adäquat zu untersuchen. Es sind Hunderte, Tausende an Parametern. Hier nutzen wir auch künstliche Intelligenz, um Zielstrukturen im Körper zu identifizieren, die wir mit bloßem Auge nicht erkennen würden.
Und so setzt dieses Konsortium den Schwerpunkt seiner Forschung in frühe Krankheitsprozesse und versucht das mit sog. Outcome-Daten, also harten klinischen Daten in den Kontext zu setzen. Wir betrachten schwere Krankheitsverläufe und überlegen: Wie sahen diese Krankheitsverläufe denn in einem frühen Stadium aus? Und hätten wir eine Möglichkeit, diese frühen Krankheitsprozesse zu stoppen oder zu behandeln?
Inzwischen gibt es auch Medikamente, die direkt an der Niere wirken. Wie beeinflusst das Ihre Forschung aus?
Wir Nephrolog:innen haben bislang den Blutdruck, den Diabetes behandelt, aber keine nierenspezifischen Therapieoptionen in die Anwendung bringen können. Das hat sich in den letzten fünf Jahren geändert mit der Einführung der SGLT2-Hemmer. Es gibt demnach verstärkte Anstrengungen, auch nierenspezifischere Therapien zu entwickeln. Unser Konsortium ist natürlich weit entfernt davon, ein Medikament zu entwickeln, aber diese Strukturen zu identifizieren, diese Prozesse früh zu erkennen, ist ja oft der erste Schritt. Auch in dem Wissen, wie wenig Fortschritt in der Nephrologie gemacht wurde in den letzten Dekaden, haben wir uns für IMMEDIATE stark gemacht . Wir freuen uns, dass die EU das ähnlich sieht.
Im Rahmen von IMMEDIATE sind auch eigene Interventionsstudien geplant – das sind Studien, bei denen u.a. die Wirkung medizinischer Maßnahmen untersucht werden. Um was geht es da konkret?
Es gibt eine Untersuchung mit rund 200 Teilnehmenden. Das sind Mitarbeitende aus einem Krankenhaus, die gefragt werden nach ihrem Stress, ihrer Schlafqualität und vielem mehr. Die Kolleg:innen aus Polen untersuchen hier den Effekt eines Probiotikums. Dabei handelt es sich um ein bislang unterschätztes Bakterium, das in verschiedenen Studien schon anti-entzündliche, also anti-inflammatorische Effekte gezeigt hat. Dieses Bakterium, das verabreicht wird, heißt Akkermansia muciniphila (A. muciniphila).
Wenn wir am Ende die Daten zusammenfassen und in der Stresssituation der untersuchten Personen diese inflammatorische Signatur erkennen und nun durch diese mikrobiomzentrierte Intervention behandeln können, ist das ein wesentlicher Schritt. Danach geht es um Fragen, wie: Welches Potenzial gibt es? Welche inflammatorische Situation sehen wir in den anderen Erkrankungen? Könnte das für die Zukunft auch ein spannender Behandlungsansatz sein? Das ist die Idee hinter IMMEDIATE, diese unterschiedlichen Expertisen zusammenzubringen.
Parallel dazu entwickelt das Konsortium eine App für Patient:innen, an der auch der BN e.V. mitwirkt...
Richtig. Denn die Expertise, die Sichtweise des Bundesverbandes Niere in ein multidisziplinäres Konsortium einzubringen, halten wir für extrem wichtig. Wir freuen uns, dass der BN e.V. dabei ist.
Das ist sozusagen der Sinn dieses interdisziplinären Unternehmens.
Wie kommt es von dem internationalen Networking auf EU-Ebene am Ende zu dieser App?
Die App soll prinzipiell den Zustand der an der Studie teilnehmenden Patient:innen erst einmal erfragen. Wir nutzen ja verschiedene grundlagenwissenschaftliche Omics-Techniken, mit denen wir viele, viele Daten produzieren und mit denen wir dann arbeiten. Für uns als Grundlagenwissenschaftler:innen ist das sehr interessant. Dem schließt sich aber die Frage an: Welche Auswirkungen haben diese entzündlichen Prozesse auf Befindlichkeit, psychosoziale Gesundheit, Stress der Patient:innen? Das sind ebenfalls wichtige Parameter, die wir einfach in vielen Studien nicht erfassen.
Also sind die Fragestellungen der App bzw. diese Parameter quasi Teil dieser Studien?
Korrekt. Es gibt ja bereits eine App, die wir aus der Studie für das Krankenhauspersonal, die das Probiotikum einnimmt, entwickelt haben. Diese funktioniert so: Die an der Studie teilnehmenden Personen geben in regelmäßigen Abständen ihre Befindlichkeiten anhand des Fragenkatalogs oder Ereignisse, die vielleicht auch ungeplant stattfinden, über diese App ein. So erhalten wir die Daten in einem standardisierten Format und können sie dann in unsere Auswertung einfließen lassen. Denn in dieser Studie mit der mikrobiomzentrierten Intervention hilft die App, die Symptome zu erfassen. Das ist sozusagen der Testlauf.
Und eine Medikamenteneinnahme im Rahmen einer Studie bei den Patient:innen ist ausgeschlossen?
Das ist richtig. Die Patient:innen müssen natürlich nichts einnehmen. Aber wenn von vornherein in die App-Entwicklung die Sichtweise von Nierenpatient:innen eingeflossen ist, dann ist das ein Mehrwert. So können wir mit den vorliegenden Ergebnissen der Studie schauen: In welchen künftigen Studien können wir diese App verwenden? Ist hier eine umfassende Plattform möglich, in die auch weitere Ergebnisse des Konsortiums einfließen? Die verschiedenen Techniken zusammen mit den appbasierten Daten generieren genau diesen Mehrwert. Das ist unser Ziel in IMMEDIATE.
Und wird daraus am Ende eine Plattform, die in künftigen nephrologischen Studien auch verwendet werden kann?
Wir sind quasi noch in der Vorphase, bevor die Studien überhaupt starten können. In den vier Jahren, in denen wir die EU-Förderung erhalten, muss die App entwickelt werden, müssen die Messungen gemacht und die Studie aufgelegt werden, müssen wir alle Bioinformatiker und IT-Spezialisten miteinander verbinden, um dann diesen Mehrwert, also die Untersuchungen durchzuführen und später die Ergebnisse zu publizieren. Das soll zusammen mit dem Bundesverband Niere passieren. Dann wird sich zeigen, ob dieser Ansatz vielversprechend ist und es eine Plattform für künftige Studien sein könnte.
Welchen Mehrwert erhoffen Sie sich durch das Projekt konkret bei der chronischen Nierenkrankheit?
Dass die Nierentransplantation als Neudefinition von Gesundheit hier in der Forschung etabliert werden konnte, ist ein wichtiges Signal, um die Anzeichen für Organverlust frühzeitig zu erkennen. Wir wollen diesen neudefinierten Gesundheitszustand erhalten. Dafür ist es essenziell, früh zu erkennen, wenn die Organfunktion nachlässt bzw. inflammatorische Prozesse aufkeimen, die vielleicht zum Organverlust führen könnten. Gleichzeitig sehen wir uns genau an, ob und wie man Zielstrukturen identifizieren kann, die eine Modifikation dieses Zustands, eine frühe Behandlung dieser krankhaften Prozesse, möglich macht.
Herr PD Dr. Nicola Wielck, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Interview: Angela Monecke
Quelle: DER:DIE NIERENPATIENT:IN 5/24
EU-Projekt IMMEDIATE – Entzündungsprozessen auf der Spur
Was wäre, wenn Krankheiten gar nicht erst entstünden? Wie genau verläuft der Übergang von Gesundheit zu Krankheit? Was sagen uns entzündliche Vorboten von Erkrankungen? Und wie beeinflussen Ernährung und Darmmikrobiom zusammen das Immunsystem? Unter der Leitung von Forschenden der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Max Delbrück Centers suchen Teams in Deutschland und mehreren europäischen Ländern nach Strategien der Gesunderhaltung sowie nach Möglichkeiten, Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Die Europäische Union fördert das Projekt IMMEDIATE in den kommenden vier Jahren mit mehr als sieben Millionen Euro.
Weitere Infos gibt es unter www.charite.de
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).