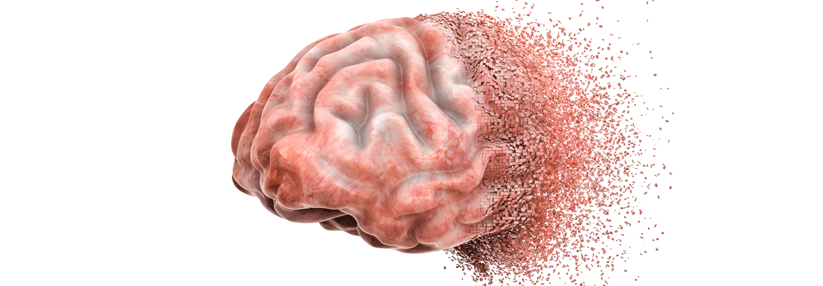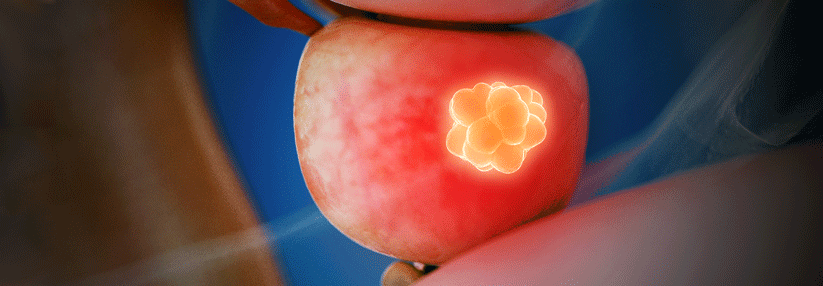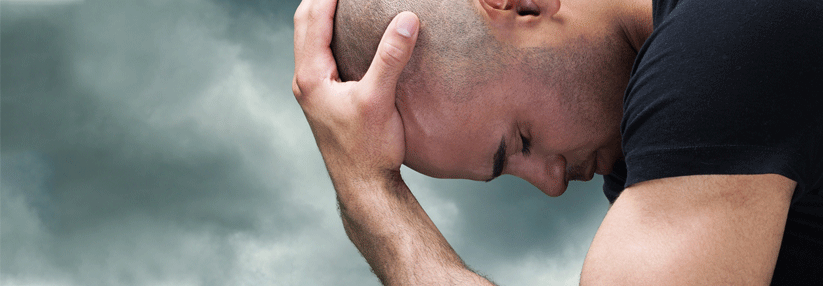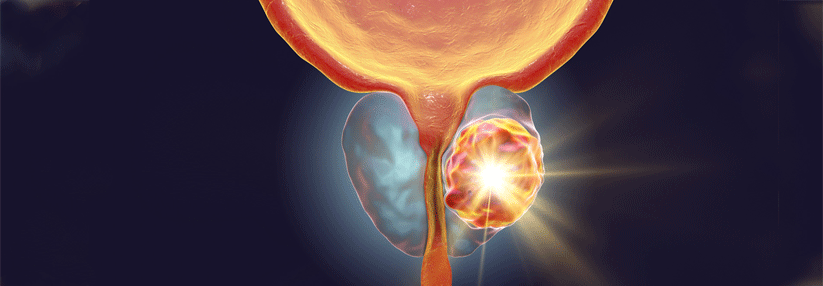
Praxistipps und Ansätze für eine bessere Versorgung
 Kolleg:innen, die eine gute Versorgungsqualität bei Prostatatumoren erreichten, lieferten wertvolle Antworten und Lösungen.
© momius – stock.adobe.com
Kolleg:innen, die eine gute Versorgungsqualität bei Prostatatumoren erreichten, lieferten wertvolle Antworten und Lösungen.
© momius – stock.adobe.com
Im Bereich des Prostatakrebs stellen besonders Patient Reported Outcomes (PRO) in Bezug auf die urologische Inkontinenz und erektile Dysfunktion die wichtigsten Messgrößen mit hohem Informationswert für Betroffene und Behandelnde dar, erklärte Prof. Dr. John Yaxley, The Wesley Hospital, Brisbane.1 Und da komme es auch auf die Methoden an, wie man diese Metriken publiziert. In Bezug auf die Kontinenz betonte er: „Ich möchte Forschende dazu ermuntern, häufiger die EPIC-26 oder EPIC-CP Fragebogen zu nutzen und zu veröffentlichen. Definieren Sie bitte nicht die Nutzung von 0–1 Inkontinenzeinlagen pro Tag als ‚kontinent‘! Hätten wir das in einer randomisierten Studie zur offenen vs. laparoskopischen radikalen Prostatektomie so gehandhabt, wären 100 % mit offener OP und 98 % mit Laparoskopie nach zwei Jahren als kontinent eingestuft worden“, betonte der Referent. Das sei eine Misrepräsentation der OP-Folgen und eine Abwertung der Bedeutung, die das Tragen der Einlagen für die Betroffenen habe.
Praxisbeispiele aus der Hamburger Martini-Klinik
Darüber, wie man im Alltag mit Qualitätsmetriken arbeiten und Erfolge erzielen kann, berichtete Prof. Dr. Markus Graefen von der Martini-Klinik in Hamburg, die weltweit als Paradebeispiel mit außergewöhnlich guten Outcomes im Bereich Prostatakrebs gilt.2 Neben der starken Spezialisierung sei die Einführung und kontinuierliche Nutzung von Qualitätskontrollen einer der entscheidenden Schlüssel zum Erfolg der Einrichtung, zeigte sich der Referent überzeugt: „Wir machen das nun seit zwanzig Jahren und es ist in unserem Zentrum zu so etwas wie einer Kultur und einer Tradition geworden.“
Führt man entsprechende Methoden neu in seiner Einrichtung ein, so sei das Wichtigste, dass die Angestellten dies als etwas Gewinnbringendes und etwas von Bedeutung verstehen – und nicht als lästige zusätzliche Bürokratie. „Wir bezeichnen es gerne als eine ‚Lebensversicherung‘ für unser Zentrum“, so der Experte. Die Initiative für eine Dateninfrastruktur sollte dabei von den Ärzt:innen ausgehen: „Überzeugen Sie Ihre:n CEO, dass diese Investition sich lohnt!“
„Eine sehr wichtige Sache, die wir gelernt haben, war, dass man dabei vorsichtig sein sollte, inwieweit man personalisierte Daten veröffentlicht“, warnte Prof. Graefen jedoch. Die Leistungen einzelner Operateur:innen publik zu machen, sei zu kleinteilig und ggf. auch für die Institution ungünstig. „Geben Sie den Patient:innen die Daten des Zentrums und vergleichen Sie sich intern miteinander“, empfahl er.
Als besonders motivierendes Beispiel für Chirurgie-Teams könnte ein 2011 publizierter Erfahrungsbericht aus der Martini-Klinik dienen. Anhand von Inkontinenzoutcomes wird darin dargestellt, wie eine besonders erfolgreiche Technik bei einem/einer Kolleg:in identifiziert wurde, wie sich daraufhin schnell auch die anderen, bereits guten Operateur:innen verbesserten, und dass neue Teammitglieder von der gesammelten Erfahrung profitieren.
Als Anekdote zur Schaffung einer entsprechenden offenen Fehler- und Kritikkultur erzählte Prof. Graefen von dem Moment, als die Daten erstmals eindeutig zeigten, dass jemand anderes als Klinikmitgründer Prof. Dr. Hartwig Huland die beste Leistung in Bezug auf die Inkontinenzrate vorzuweisen hatte. Alle warteten gespannt auf seine Reaktion. Und dieser kommentierte: „Oh wow, das ist fantastisch! Ich bin so gespannt, was Sie anders machen, bitte lassen Sie mich Ihnen bei Ihren Eingriffen assistieren.“
Pro und Contra Zentralisierung
Eine Konzentration von Krebsbehandlungen in Spezialzentren kann die Versorgungsqualität verbessern – tut sie jedoch nicht immer automatisch, betonte Prof. Dr. Paul Cathart vom Guy’s and St. Thomas‘ Krankenhaus in London.1 Ein wichtiger bekannter Faktor bestehe dabei in der „Volume-Outcome“-Beziehung, laut der eine höhere OP-Fallzahl mit besseren funktionellen Resultaten und weniger Varianz einhergeht. Die kritische Marke, um diesen Vorteil auszuschöpfen, liege laut Literatur bei etwa 100 Fällen pro Einrichtung und Jahr. Allerdings zeigte der Referent auch Gegenbeispiele aus Schottland und Belgien, in denen die Outcomes trotz Zentralisierung unverändert blieben. Sein Fazit lautet angesichts dessen: Zur Translation in bessere Outcomes müsse aktiv mit Qualitätsdaten gearbeitet werden. „Dieser Prozess ist allerdings unmöglich mit geringen Patient:innenzahlen, also ohne Zentralisierung“, resümierte Prof. Cathart. Zur Weiterentwicklung von Operationstechniken brauche es immer Outcome-Daten. „Und zwar viele davon.“ In Kombination damit biete sich Videomaterial von Eingriffen sehr gut an, um eine „best practice“ zu identifizieren.
Als Argumente gegen eine Zentralisierung nannte Prof. Dr. Pim Van Leeuwen vom Netherlands Cancer Institute aus Amsterdam zum einen, dass es bei der „Volume-Outcome“-Beziehung offenbar nicht auf den Umsatz des Zentrums, sondern das Pensum der oder des jeweiligen Operierenden ankomme.2 Außerdem habe die Zentralisierung für Patient:innen offenkundig auch Nachteile, wie einen Verlust wohnortnaher Angebote, und als Folge eine verstärkte sozio-ökonomische Ungleichheit in der Versorgung. Darüber hinaus sinke die Qualifikation in lokalen Urologie-Teams. Als Alternative zur physikalischen Zentralisierung schlug Prof. Van Leeuwen daher vor, in Krebsnetzwerken mit einem Fokus auf Qualität zusammenzuarbeiten. Auch auf diese Weise kann man nach Ansicht des Experten relevante Daten sammeln, sich vergleichen und voneinander lernen. Diagnose, Behandlungsplan und Nachsorge könnten im nahegelegenen Krankenhaus geleistet werden, sodass der Patient oder die Patientin nur gegebenenfalls für einen Eingriff einmalig in ein regionales Expertenzentrum reisen müsse.
Quellen:
1. Cathart P. 40th Annual EAU Congress; Vortrag „Pro centralisation“
2. Van Leeuwen P. 40th Annual EAU Congress; Vortrag „Against centralisation“
„Die Chirurgie ist keine Kunst mehr, sondern Wissenschaft“
Mit dem Einzug von Qualitätsmetriken in die Prostatakrebsversorgung ändern sich Training und Berufsbild von Operierenden grundlegend, erklärte Prof. Dr. Alexandre Mottrie von der ORSI Academy in Ghent. „Die Chirurgie ist keine Kunst mehr. Sie ist eine Wissenschaft“, so sein Statement.3 Und Veränderung sei dringend nötig. Einer Publikation aus 2017 zufolge war der „beängstigende“ Anteil von rund einem Drittel der US-amerikanischen Operateur:innen nach abgeschlossener Ausbildung nicht in der Lage, eigenständig Eingriffe durchzuführen.
Diese Problematik habe verschiedene Gründe. Es müssten heute viele verschiedene Techniken gelernt werden, bei weniger Möglichkeiten für Hands-on-Erfahrungen. Den Begriff der „Lernkurve“ beleuchtete der Referent sehr kritisch: „Was ist denn eigentlich eine Lernkurve? Es bedeutet, dass wir unsere Patient:innen benutzen, um an ihnen zu lernen.“ Das hält der Kollege für nicht länger akzeptabel. Um die chirurgische Ausbildung auf das nächste Level zu heben, brauche es Standardisierung, validierte Trainingswege abseits des Operationssaals, Qualitätsstandards, internationale Lizensierung und auch Re-Lizensierung. In der Vergangenheit brachten Qualitätsmetriken sogar ans Licht, dass selbst von zwölf ausgewählten, erfahrenen Operateur:innen, von denen die meisten Live-OPs durchführten und alle Nachwuchs ausbildeten, zwei unterhalb und einer auf dem Niveau der Trainees agierten.
Die von Prof. Mottrie mitentwickelte Methode Proficiency Based Progression (PBP) basiert darauf, eine Prozedur in eine Matrix kleiner, klar quantifizierbarer Bausteine zu unterteilen. Für die robotische radikale Prostatektomie sind dies 80 Schritte, mit knapp 250 identifizierten häufigen Fehlerquellen unterschiedlichen Schweregrades. Jeder einzelne Schritt wird bis zur Beherrschung geübt.
„Die Leistung der PBP-Trainees ist 60 % besser als bei der herkömmlichen Ausbildung“, betonte Prof. Mottrie. Das Konzept soll nun auch auf das „CC-ERUS“ Curriculum zur robotischen radikalen Prostatektomie angewandt werden.
Quellen:
1. Yaxley J. 40th Annual EAU Congress; Vortrag „Quality metrics in prostate cancer“
2. Graefen M. 40th Annual EAU Congress; Vortrag „How to work with quality metrics?“
3. Mottrie A. 40th Annual EAU Congress; Vortrag „The impact of training quality on prostate cancer care“
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).