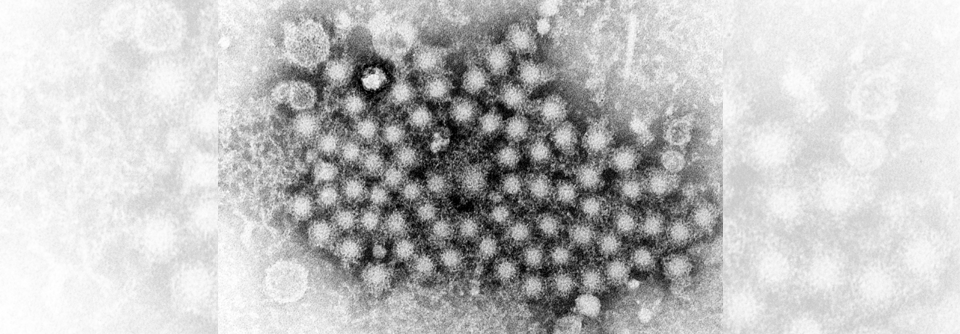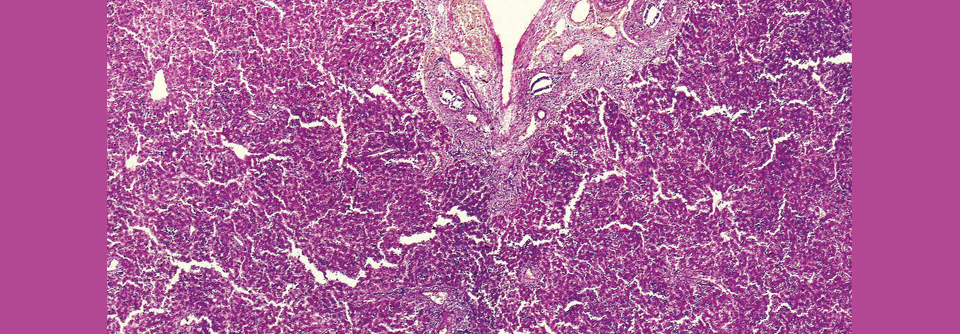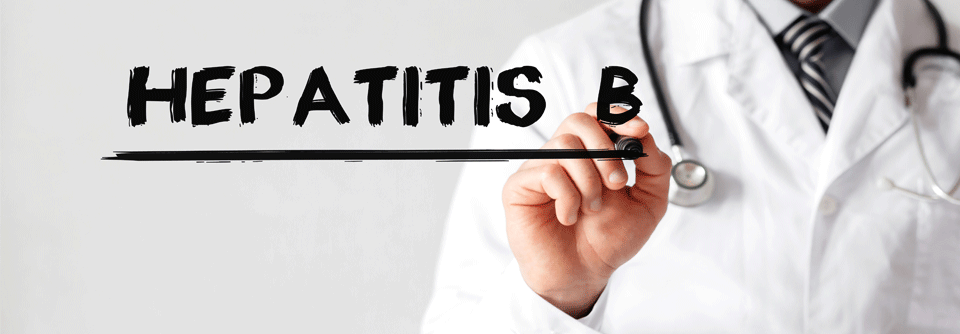State of the Art und Zukunftsperspektiven für die CHD-Therapie
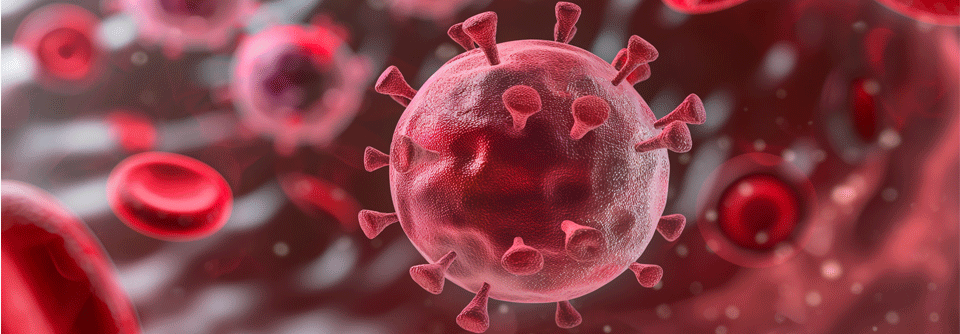 Die chronische Hepatitis D (CHD) stellt die schwerste Form unter den Virushepatitiden dar.
© Imagecreator – stock.adobe.com
Die chronische Hepatitis D (CHD) stellt die schwerste Form unter den Virushepatitiden dar.
© Imagecreator – stock.adobe.com
Die chronische Hepatitis D (CHD) stellt die schwerste Form unter den Virushepatitiden dar. Betroffene tragen ein besonders hohes Risiko für die Entwicklung einer Zirrhose und Komplikationen wie ein hepatozelluläres Karzinom oder eine hepatische Dekompensation.
Jahrzehntelang wurden Patientinnen und Patienten mit CHD in der Regel mit pegyliertem Interferon-α (PegIFN-α) behandelt. Neben den begrenzten virologischen Ansprechraten ist allerdings die schlechte Verträglichkeit dieser Behandlung ein limitierender Faktor. In einer aktuellen Übersichtsarbeit skizziert ein Autorenteam um Prof. Dr. Pietro Lampertico von der Universität Mailand die neuesten Entwicklungen in der Therapielandschaft der CHD.
Bulevirtid
Seit knapp fünf Jahren ist Bulevirtid in einer Dosierung von 2 mg/Tag in Europa zur Behandlung von erwachsenen CHD-Patientinnen und -Patienten mit kompensierter Lebererkrankung zugelassen. Als erster Vertreter der sogenannten Entry-Inhibitoren hindert er Hepatitis-B-Viren (HBV) und Hepatitis-D-Viren (HDV) daran, in Hepatozyten einzudringen. Dieser Effekt basiert auf der Bindung des Wirkstoffs an den Natrium-Taurocholat-Cotransporter (NTCP).
Bulevirtid hat sich sowohl in klinischen Studien als auch in der Praxis als sichere und wirksame Monotherapie über bis zu 144 Wochen erwiesen. Dabei zeigte sich unter anderem, dass eine langfristige Behandlung mit Bulevirtid das Risiko für eine Dekompensation bei Personen mit Zirrhose reduzieren kann. Vielversprechende Ergebnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit wurden auch bei Menschen mit CHD und einer HIV-Koinfektion erzielt.
Die Therapie mit Bulevirtid hat jedoch auch Grenzen. So ist sie nicht nur kostspielig, sondern erzielt auch nur niedrige Raten an Behandelten mit negativem HDV-RNA-Nachweis. Darüber hinaus konnte kein relevanter Rückgang des Hepatitis-B-Oberflächenantigens (HBsAg) nachgewiesen werden. Dieser wäre bedeutsam für den Therapieerfolg. Zuletzt ist außerdem in den meisten Fällen eine Langzeitbehandlung erforderlich, da bei Absetzen der Therapie ein hohes Rückfallrisiko besteht.
Kombinationstherapie
Einen alternativen Therapieansatz zur Monotherapie stellt die Kombination von Bulevirtid 2 mg mit PegIFN-α dar. Studienergebnisse deuten darauf hin, dass sich unter der Kombinationstherapie die Nichtnachweisbarkeitsraten für HDV-RNA verbessern lassen. Weiterhin erzielte zumindest ein Teil der Studienteilnehmenden einen relevanten HBsAg-Verlust. Allerdings war die virologische Suppression 24 Wochen nach Beendigung der Therapie bei den mit PegIFN-α plus Bulevirtid 2 mg/Tag behandelten Patientinnen und Patienten ähnlich wie bei den nur mit PegIFN-α Behandelten, schreiben die Autorinnen und Autoren. Sie resümieren, dass die Ergebnisse nach der Therapie günstiger für die Kombination von PegIFN-α und BLV 10 mg ausfielen, dieletztgenannte Dosis allerdings derzeit nicht verfügbar ist.
Lonafarnib
Ein weiterer Wirkstoff, der aktuell in klinischen Studien zur Behandlung von CHD geprüft wird, ist Lonafarnib. Hierbei handelt es sich um einen Farnesyltransferasehemmer, der oral verabreicht wird. Er wird in der Regel mit Ritonavir kombiniert, um gastrointestinalen Nebenwirkungen vorzubeugen.
In Phase-2-Studien wurden vielversprechende virologische Ansprechraten auf eine Behandlung mit Lonafarnib und Ritonavir mit oder ohne PegIFN-α beobachtet. Diese Ergebnisse konnten in Phase-3-Studien allerdings bislang nicht bestätigt werden.
Weitere experimentelle Wirkstoffkandidaten
REP 2139 ist ein Nukleinsäurepolymer, das den Zusammenbau subviraler HBV-Partikel blockiert und damit den Abbau des intrazellulären HBsAg fördert sowie die HDV-Replikation inhibiert. Weitere Daten, einschließlich aus großen Phase-2-Studien, sind erforderlich, um die Wirksamkeit und Sicherheit bei CHD zu bestätigen.
Ein weiterer interessanter Ansatz, der in die HBV-Genexpression eingreift, ist die Behandlung von CHD mittels small interfering RNA (siRNA) oder monoklonalen Antikörpern (moAB). Insbesondere die Kombination aus siRNA und moAB erwies sich dabei als wirkungsvoll. So wurde in Studien eine Reduktion der HDV-RNA und des HBsAg-Spiegels innerhalb von 12 bis 24 Wochen nach Therapiebeginn festgestellt. Die Expertinnen und Experten schätzen die Ergebnisse dahingehend ein, dass eine frühe virologische Suppression während dieser Kombinationstherapie tiefgreifender zu sein scheint als die Monotherapie mit Bulevirtid. Eine randomisierte kontrollierte Studie hierzu ist allerdings noch nicht verfügbar.
Quelle: Lampertico P et al. Gut 2024; doi: 10.1136/gutjnl-2024-332597
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).