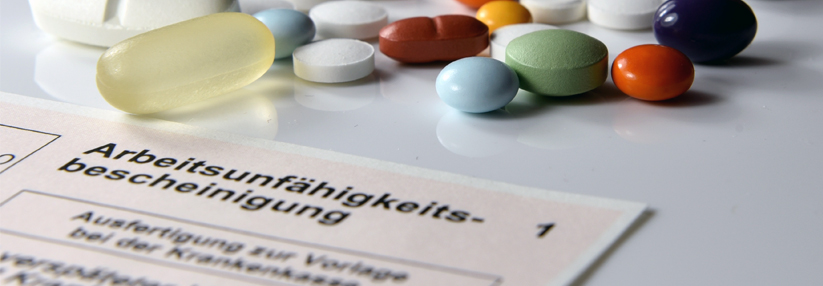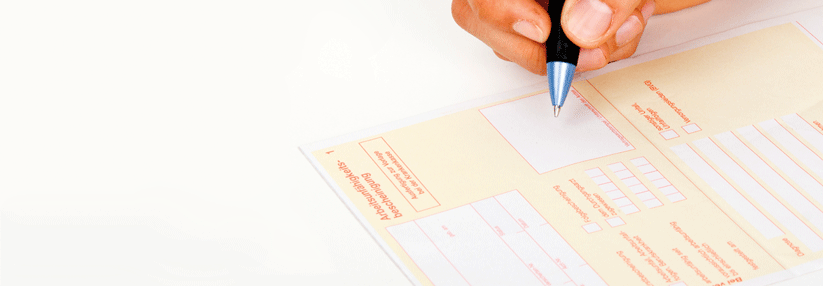Kündigung auf ärztlichen Rat – so rechnen Sie ab
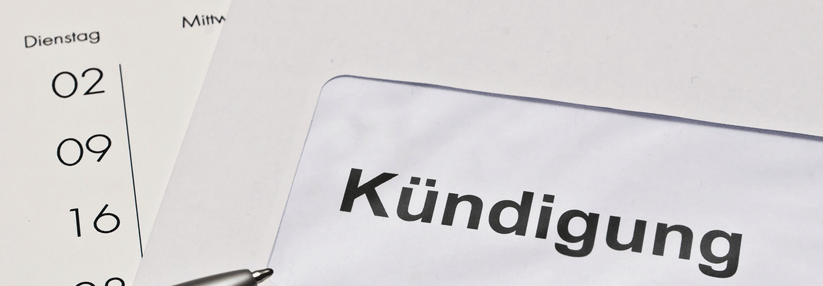 Wann und wie das Formular zum Einsatz kommt, das unter dem Job leidenden Patienten helfen kann.
© fotolia/ Stockfotos-MG
Wann und wie das Formular zum Einsatz kommt, das unter dem Job leidenden Patienten helfen kann.
© fotolia/ Stockfotos-MG
Wenn ein Patient in die Praxis kommt und sagt "Ich war beim Arbeitsamt und der Sachbearbeiter hat gesagt, ich soll ein Attest / ärztliche Unterlagen bringen, damit ich nach meiner Kündigung nicht gesperrt werde", dann sollten Sie wissen, was zu tun ist, damit Ihrem Patienten kein Schaden entsteht und Sie keinen unnötigen oder unbezahlten Einsatz bringen müssen.
Auf dem 11. IhF-Fortbildungskongress in Mannheim erklärten die Hausärzte Timo Schumacher und Dr. Sabine Frohnes die Hintergründe und gaben Tipps zur Abrechnung. Oft ist der Hausarzt einer der Ersten, der erfährt, wenn sich ein Patient ernsthaft unwohl mit seinem Arbeitsverhältnis fühlt. Der Patient erzählt von Schlafstörungen und Stress-Symptomen, manche brauchen Auszeiten.
Lässt sich die Situation auf Dauer nicht auflösen, kann es zu belastenden Patt-Situationen kommen, in denen das Arbeitsverhältnis niemandem mehr gut tut, aber auch keiner die Kündigung ausspricht, da der Arbeitgeber die Auseinandersetzung vor dem Arbeitsgericht scheut und der Arbeitnehmer keine dreimonatige Sperre der Agentur für Arbeit riskieren möchte.
Einen Ausweg aus dem Dilemma gibt es aber: Liegen entsprechende Gründe vor, dass eine Kündigung "auf ärztlichen Rat" erfolgt, hat die Agentur für Arbeit den Ermessensspielraum, die Drei-Monatssperre nicht wirksam werden zu lassen.
Beratungsgespräch muss vor Kündigung erfolgt sein
Wichtig ist: Sie müssen in der Patientenakte vermerkt haben, dass Sie mit dem Patienten vor (!) seiner Kündigung über dieses Problem gesprochen haben. Und: Sie müssen das entsprechende Formular der Bundesagentur ausfüllen. Kern des Formulars ist die Zeile: "Ich habe daher am xx empfohlen, die Beschäftigung aufzugeben."
Die Antworten auf die weiteren Fragen des Formulars können vom Patienten bereits im Vorfeld entworfen werden. Abgerechnet wird dann mit den GOÄ-Ziffern 80 und 95. Damit kommt man auf die Summe 20,99 Euro zum einfachen Gebührensatz – ein angemessenes Honorar.
Tipp: Geben Sie dem Patienten das ausgefüllte Formular mit. Denn, so Dr. Frohnes, der Teufel steckt im Detail: "Ich weiß nur einen Fall aus meiner Praxis, in dem der Patient trotz Bestätigung des ärztlichen Rates die Dreimonatssperre erhalten hat – der Brief war einfach nie bei der Agentur angekommen."
Quelle: 11. IhF-Fortbildungskongress
Kündigung auf ärztlichen Rat - wichtige Fragen im Überblick
In welchen Fällen können Ärztinnen und Ärzte eine Kündigung nahelegen?
Eine Kündigung auf ärztlichen Rat kommt immer dann in Betracht, wenn jemand bestimmte berufliche Tätigkeiten aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann und die Leistungsfähigkeit im aktuellen Job aus medizinischen Gründen eingeschränkt ist. Dies erklärt Dr. Justin Doppmeier, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei KWM Law in Münster. Diese Gründe gelte es explizit und aussagekräftig darzustellen. „Insbesondere sollte dabei der Zusammenhang zwischen den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Arbeitnehmers und der beruflichen Tätigkeit aufgezeigt werden.“
Reicht alternativ ein ärztliches Attest?
Grundsätzlich ist es ratsam, den Fragebogen zu verwenden, den die Agenturen für Arbeit zur Verfügung stellen. Er enthält alle Angaben, die benötigt werden, um über die Sperrfrist zu entscheiden. So können Rückfragen wegen fehlender Daten vermieden werden, während gleichzeitig keine unnötigen erhoben werden, argumentiert die Bundesagentur für Arbeit. Außerdem bestehe für die Kundinnen und Kunden eine Mitwirkungspflicht. Soweit Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese verwendet werden (§ 60 Absatz 2 SGB I). In Einzelfällen könne aber auch eine andere Form zulässig sein.
In der Tat sei die Verwendung des Fragebogens nicht zwingend, bestätigt Fachanwalt Dr. Doppmeier. Ein aussagekräftiges ärztliches Attest genüge ebenfalls, damit die Agentur prüfen kann, ob ein objektiv wichtiger Kündigungsgrund vorliegt. Aus dem Attest müsse aber deutlich hervorgehen, dass bestimmte Tätigkeiten aus ärztlicher Sicht nicht mehr ausgeübt werden können und die Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers aus medizinischen Gründen eingeschränkt ist.
Wie muss der ärztliche Rat zur Kündigung festgehalten werden?
Empfehlen Ärztinnen und Ärzte aus gesundheitlichen Gründen, den Job zu kündigen, muss dies in einem Formular der Agentur für Arbeit festgehalten werden. Es trägt den Titel „Fragebogen zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses auf ärztlichen Rat“. Die Patientin bzw. der Patient sollte es von der Agentur erhalten haben und in die Sprechstunde mitbringen. Online kursiert zwar eine Version von 2007, die Bundesagentur für Arbeit weist jedoch darauf hin, dass diese veraltet ist. Sie schreibt, die Agenturen händigten ihren Kundinnen und Kunden das aktuelle Formular nur im konkreten Bedarfsfall aus.
Übrigens: Nicht mit allen offenen Feldern des Fragebogens müssen sich Ärztinnen und Ärzte selbst herumschlagen. Den ersten Teil können Patientinnen und Patienten vorab allein ausfüllen. Relevant ist erst die „ärztliche Stellungnahme“. Kern des Formulars ist die letzte Zeile: „Ich habe daher am xx empfohlen, die Beschäftigung aufzugeben.“
Erfolgt eine Überprüfung der ärztlichen Begründung durch Gutachter der Agentur für Arbeit?
Die Bundesagentur für Arbeit schreibt, die Leistungsbearbeitung erfolge nicht durch medizinisches Personal, sodass die ärztliche Bescheinigung im Regelfall ohne inhaltliche Überprüfung der Begründung akzeptiert werde. „Sollten im Einzelfall dennoch Zweifel bestehen, wäre der Ärztliche Dienst der Bundesagentur für Arbeit mit Klärung von Fragen zu den gesundheitlichen Einschränkungen, die die Kundin oder der Kunde angegeben hat, zu beauftragen; dies stellt jedoch keine Überprüfung der eingereichten ärztlichen Bescheinigung dar.“
Anhand welcher Kriterien erwägen die Agenturen für Arbeit, ob sie eine Sperrfrist verhängen?
Um über eine Sperrfrist zu entscheiden, wird laut Bundesagentur für Arbeit das Individualinteresse an der Kündigung mit dem „Gemeinschaftsinteresse aller Beitragszahler am Erhalt der Beschäftigung“ abgewogen. Dabei würden alle Umstände des jeweiligen Einzelfalls berücksichtigt. Liege eine ärztliche Bescheinigung vor, erkenne man den wichtigen Grund in der Regel an. Es müsse aber erkennbar sein, dass der Rat vor der Kündigung erfolgte. Eine ärztliche Bestätigung im Nachhinein genüge nicht.
Wie wird der Rat zur Kündigung korrekt abgerechnet?
Beim Ausstellen der Bescheinigung zur Kündigung auf ärztlichen Rat handelt es sich nicht um eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen, erklärt der Abrechnungsexperte und langjährige Hausarzt Dr. Gerd W. Zimmermann. Die Abrechnung erfolgt daher nach GOÄ. In Betracht kommen die Nrn. 80 (Schriftliche gutachtliche Äußerung, Einfachsatz: 17,49 Euro) und 95 (Schreibgebühr, je angefangene DIN-A4-Seite, Einfachsatz: 3,50 Euro). Auch die Agentur für Arbeit weist auf diese Abrechnungsmöglichkeit hin. Ärztinnen und Ärzte können die Kosten demnach der lokalen Agentur für Arbeit in Rechnung stellen.
Müssen Beschäftigte vorab versucht haben, die Arbeitsbedingungen zu verändern?
Der Fragebogen der Agentur für Arbeit fragt explizit ab, ob die betreffende Person bereits versucht habe, die gesundheitlichen Belastungen gemeinsam mit dem Arbeitgeber zu vermeiden, etwa durch eine interne Versetzung. Muss solch ein Versuch also zwingend unternommen worden sein?
Die Antwort sei nicht ganz einfach, meint Fachanwalt Dr. Doppmeier. Nach den internen Weisungen der Arbeitsagenturen könne ein wichtiger Grund zwar nur anerkannt werden, wenn der oder die zukünftig Arbeitslose einen „zumutbaren Versuch“ unternommen hat. Eine pauschale Aussage sei aber trotzdem nicht möglich. Allgemein erscheine es sicherer, gegenüber dem Arbeitgeber eine Änderung der Arbeitsbedingungen anzuregen, empfiehlt er. Es kämen etwa Gespräche mit Vorgesetzten, der Einsatz in einer anderen Abteilung sowie eine Reduzierung der Arbeitstätigkeit in Betracht. Dr. Doppmeier rät Betroffenen dazu, diese Versuche zu dokumentieren, damit sie diese im Zweifel nachweisen können, z. B. durch E-Mails oder Gesprächsprotokolle.
Von der Produktion in die Buchhaltung?
Die Bundesagentur für Arbeit gibt folgendes Beispiel für einen Wechsel des Aufgabengebiets: Eine Arbeitnehmerin verträgt den Umgang mit chemischen Substanzen nicht mehr. Ihr wird ärztlicherseits geraten, die Beschäftigung zur Vermeidung schwererer gesundheitlicher Komplikationen zu beenden. Bevor die Kundin endgültig kündigt, müsste sie ihre Arbeitgeberin oder ihren Arbeitgeber nach alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb des Betriebes fragen, die keinen Kontakt mit den chemischen Substanzen erfordern (z. B. Buchhaltung).
zuletzt aktualisiert am 07.03.2025