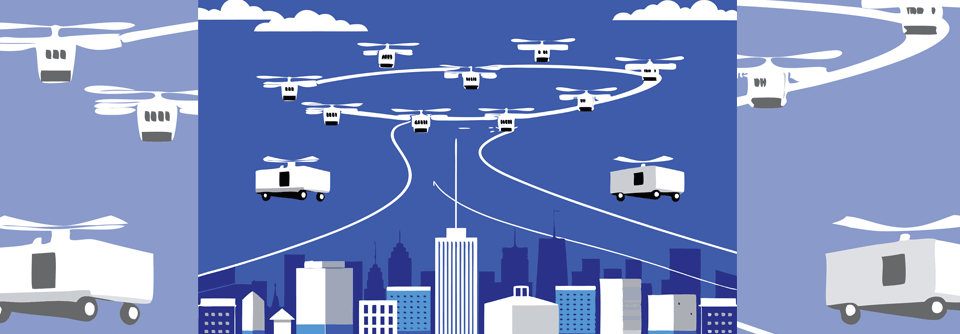Ungewohnte Flugobjekte: Transport per Drohne wird in der Medizin vorsichtig erprobt
 Drohnen könnten beispielsweise Gewebe- und Blutproben flott von A nach B bringen. (Agenturfoto)
© phoenix021 – stock.adobe.com
Drohnen könnten beispielsweise Gewebe- und Blutproben flott von A nach B bringen. (Agenturfoto)
© phoenix021 – stock.adobe.com
Nur gut elf Minuten dauerte der Jungfernflug des GUAV8L, einer speziell für medizinische Einsätze konzipierten Drohne. In dieser Zeitspanne überwand das Gerät eine Strecke von rund fünfeinhalb Kilometern Luftlinie in 75 Metern Höhe. Im Gepäck: Eine Box, wie sie üblicherweise für den Transport von Gewebeproben genutzt wird. Sie wurde vom Bundeswehrkrankenhaus im Hamburger Stadtteil Wandsbek-Gartenstadt zum Katholischen Marienkrankenhaus in Hamburg-Hohenfelde gebracht.
Schneller Transport von Gewebe oder Blut per Drohne
Der Testflug erfolgte Anfang Februar im Rahmen des vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) geförderten Projekts Medifly. Er sollte demonstrieren, dass der Gewebetransport in einer Großstadt mittels Drohne sowohl sicher als auch schneller als auf der Straße erfolgen kann. Mit Erfolg. Denn die Beförderung mit Taxi oder Rettungswagen dauert auf der etwa sieben Kilometer langen Strecke zwischen den beiden klinischen Einrichtungen nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) im Schnitt ungefähr 30 Minuten, je nach Verkehrslage auch länger.
„Der Vorteil von Gewebetransporten per Drohne ist immens“, sagt Ursula Störrle-Weiß, Geschäftsführerin des Medizinischen Versorgungszentrums am Marienkrankenhaus und verantwortlich für das Institut für Pathologie. Durch den schnellen Transport ließen sich die Operations- und Narkosezeiten verkürzen, was sowohl den Operateuren als auch den Patienten zugutekomme.
Nach einem mehrmonatigen Erprobungsbetrieb soll untersucht werden, welche Voraussetzungen für einen wirtschaftlich lohnenden Einsatz erforderlich sind. Neben Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie verkürzten Transportzeiten fallen hierunter laut BMWE auch technische und witterungsbedingte Aspekte.
Plakette, Lizenz, Erlaubnis, Sondergenehmigung
BMG fördert Studie zum Transport von Defibrillatoren
Die Bundesregierung steht den zivilen Anwendungen dennoch grundsätzlich positiv gegenüber. Das belegt auch die Förderung des Greifswalder Pilotprojekts. Hier unterstützt das Bundesgesundheitsministerium mit etwas über 400 000 Euro eine im August letzten Jahres angelaufene Machbarkeitsstudie, bei der Drohnen Defibrillatoren transportieren. Das Projekt wird von der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Greifswald geleitetet. Es soll zeigen, ob sich mithilfe der Fluggeräte Lücken in der Erstversorgung in dünn besiedelten Gebieten schließen lassen. Der Versuchsablauf: Bei einem Notfall aktiviert die Leitstelle per Knopfdruck eine Drohne mit Defibrillator an Bord. Zeitgleich wird ein in der Reanimation geschulter Helfer per Smartphone-App alarmiert und zum Notfallort geschickt. Die stellvertretende Projektleiterin, Dr. Mina Baumgarten, ist nach 48 Probedurchläufen zuversichtlich, dass sich das System für den Echtbetrieb eignet. Die GPS-gesteuerten Drohnen hätten selbst bei Hochnebel fliegen können. Kalkulatorisch hätten sich an einzelnen Standorten bereits Hinweise auf einen Zeitvorteil gegenüber dem Straßentransport gezeigt. „Auch konnten wir beweisen, dass die Ersthelfer in der Lage sind, den Defibrillator problemlos zu entnehmen und anzuwenden“, so Baumgarten. Voraussetzung für den Erfolg sei, das Gesamtsystem weiterzuentwickeln. Drohnen müssten fest installierte Defibrillatoren ergänzen, Konzepte zur Alarmierung von geschulten Helfern ausgebaut werden. „Derzeit gibt es in den meisten Regionen noch zu wenige Defibrillatoren. Deren Standorte sind zudem bislang nicht kartiert“, merkt Baumgarten an. In Mecklenburg-Vorpommern sei der Arbeiter Samariter Bund aber dabei, eine entsprechende Datenbank aufzubauen, die per Handy-App zugänglich ist. Für die Nutzung von Drohnen müssen klare Regeln eingehalten werden, die in der 2017 in Kraft getretenen Drohnenverordnung der Bundesregierung festgeschrieben sind. Auch müssen sich die Betreiber je nach Standort im Vorfeld mit zahlreichen Stellen abstimmen, darunter Naturschutz- und Wasserschutzverbände, die Bundespolizei sowie Landesbehörden. Besonders herausfordernd ist der Einsatz der Technik innerhalb der Kontrollzone von Flughäfen. Hier geht ohne grünes Licht der jeweiligen Landesluftfahrtbehörde sowie der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) nichts. Eine Risikobewertung sei dabei immer nur in der Einzelfallbetrachtung möglich, betont Ute Otterbein von der DFS. Im Raum Frankfurt scheiterte ein Projekt unter anderem aus diesem Grund. Hier hatte vor circa fünf Jahren der Anästhesist und Leiter der Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken, Dr. Dennis Göbel, die Idee, Transportflüge von Blutprodukten und Blutproben mittels Drohne zu absolvieren. Eines der Projektkrankenhäuser lag nach Aussage von Otterbein jedoch zu dicht an der Kontrollzone des Frankfurter Flughafens. „Hauptgrund waren jedoch die fehlenden gesetzlichen Grundlagen, insbesondere für Drohnenflüge außerhalb der Sichtweite des Piloten“, so Dr. Göbel. Dennoch hält er an seiner Idee fest und verfolgt das Projekt seit Mitte 2018 als Vorstand und Leiter der Stiftung Kreuznacher Diakonie von seinem neuen Standort in Bad Kreuznach weiter. Aus seiner Sicht ist es wichtig, dass Drohnen für die Nutzung in der Gesundheitsversorgung über spezielle technische Features verfügen, die eine größtmögliche Sicherheit gewährleisten. „Die Elektronik beispielsweise sollte mehrfach redundant abgesichert sein“, sagt Dr. Göbel. Die Fluggeräte sollten zudem für den Fall eines Absturzes mit einem Fallschirm ausgestattet sein.Drohnen können per Internetverbindung gesteuert werden
Wie in Hamburg und Greifswald kommen auch in Ostwestfalen Drohnen des Delbrücker Unternehmens Globe UAV zum Einsatz, das einige Modelle den speziellen Anforderungen an zivile Flüge im Gesundheitswesen angepasst hat: „Statt über eine Funkfernsteuerung werden die Drohnen über eine mobile Internetverbindung gesteuert“, erklärt Geschäftsführer Jörg Brinkmeyer. Die Funklöcher, die man vom Telefonieren am Boden kennt, seien in 50 bis 70 Metern Höhe kein Problem. „Außerdem können wir auch über längere Distanzen eine dauerhafte Kontrolle über das Gerät gewährleisten und sind nicht auf einen permanenten Sichtkontakt angewiesen, da wir den Flug via Bildschirm verfolgen.“ Der Operator habe zudem jederzeit Zugriff auf das System und könne den Flug manuell steuern. Die Testflüge der Drohnen mit Blutprodukten im Gepäck seien vielversprechend verlaufen, so Brinkmeyer. Dr. Göbel hofft daher, noch in diesem Jahr mit Transportflügen zwischen den 30 Kilometer voneinander entfernt liegenden Hunsrück Kliniken in Simmern und dem Krankenhaus der Diakonie in Bad Kreuznach beginnen zu können. Eine Genehmigung bei der zuständigen Landesbehörde sei beantragt. Drei seiner Mitarbeiter hätten außerdem bereits die Schulung als Drohnenpilot bei der DFS absolviert. Drei weitere sollen folgen.Geschätzte Kosten von drei bis vier Euro pro Kilometer
Der Anästhesist rechnet damit, dass die Drohnen im Regelbetrieb drei bis vier Euro pro geflogenem Kilometer kosten. Für den Transport von Blutproben mit einem Rettungswagen fielen dagegen derzeit bis zu 300 Euro an. Die Anschaffung einer Drohne ist gleichwohl teuer. „Je nach Ausstattung können bis zu sechsstellige Beträge anfallen“, sagt Dr. Göbel. Die Krankenkassen reagieren bislang zurückhaltend auf den Einsatz der Fluggeräte. Bei der DFS dagegen stoßen die Pilotprojekte allesamt auf ein positives Echo. „Wir sehen gute Einsatzmöglichkeiten für Drohnen in der Gesundheitsversorgung“, sagt Otterbein und pocht zugleich auf eine Versachlichung der Diskussion um die kleinen Flugobjekte.Medical-Tribune-Recherche