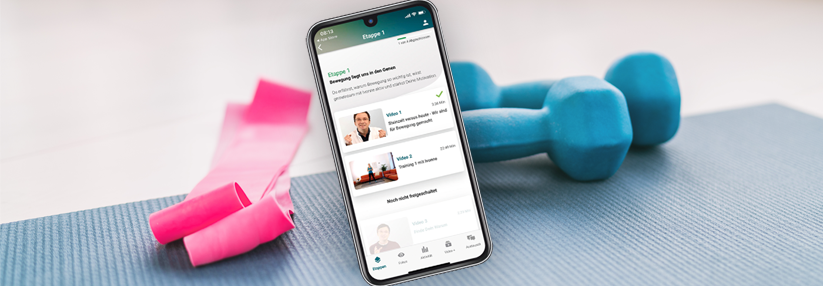Sprache und Diabetes „Statt zu essen, sollten Sie lieber nach draußen gehen!“
 Die Initiative „Language Matters Diabetes“ möchte für den Sprachgebrauch im Patientengespräch sensibilisieren.
© DragonImages – stock.adobe.com
Die Initiative „Language Matters Diabetes“ möchte für den Sprachgebrauch im Patientengespräch sensibilisieren.
© DragonImages – stock.adobe.com
In manchen Praxen und Kliniken fallen Sätze wie: „Wenn Sie sich nicht besser um Ihren Diabetes kümmern, müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie blind an der Dialyse landen.“ Immer wieder bekommen Patienten mit Diabetes solche stigmatisierenden und beschuldigenden Phrasen zu hören.
Bereits seit 2011 versucht die globale Initiative „Language Matters Diabetes“ daher, sowohl medizinisches Personal als auch Laien im Sprachgebrauch zu sensibilisieren. In Deutschland unterstützen nun drei Organisationen die Initiative: die Deutsche Diabetes Gesellschaft, diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe und die Diabetes-Online-Community „dedoc“.
In einem 43-seitigen Positionspapier raten sie zu einem sensibleren Sprachgebrauch. Beispielsweise ist dort nachzulesen, warum die Begriffe „Zuckerkrankheit“, „Compliance“ oder „Adhärenz“ zu vermeiden sind.
Sprache wie eine Leitlinie aktualisieren
Koautorin des Papiers ist die Diabetologin und Kinder- und Jugendärztin Dr. Katharina Braune. Sie betont, dass Sprache nichts Absolutes sei. So wie Leitlinien regelmäßig überarbeitet und an den neuesten Stand der Erkenntnis angepasst würden, müsse man auch den Sprachgebrauch immer wieder überdenken.
Eine verletzende und demotivierende Wortwahl sei nicht nur für sich genommen problematisch, sondern könne auch medizinische Folgen haben, ergänzt DDG-Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Fritsche. Denn sie beeinflusse, wie Patienten über ihre Erkrankung denken und wie sie ihre Therapie umsetzen. Oft würde der wenig konstruktive Eindruck vermittelt, Diabetes sei einfach nur ein lebensverschlechterndes Problem. Besonders den Moment der Diagnosestellung würden viele Patienten als Trauma erleben. Teils indizierten medizinisch veraltete Begriffe auch eine Fehlbehandlung, gibt der Diabetologe zu bedenken – etwa das Wort „Insulinnachspritzplan“. Schließlich sollte nicht auf einen hohen Blutzucker gewartet, sondern bereits vor dem Essen gespritzt werden.
Der DDG-Vizepräsident rät dazu, sich bewusst zu machen, wie negativ das eigene Bild von Patienten mit Diabetes eigentlich ist. Denkt man bei dem Begriff beispielsweise zunächst an übergewichtige Menschen?
Entscheidungen partizipativ treffen
Dr. Jens Kröger, niedergelassener Diabetologe in Hamburg und Vorstandsvorsitzender von diabetesDE, fordert Ärzte dazu auf, die partizipative Entscheidungsfindung wirklich zu leben – Patienten also aktiv in die Therapiewahl miteinzubeziehen. Dies sei in der Nationalen Versorgungsleitlinie Typ-2-Diabetes explizit vorgesehen. Die Umsetzung gelinge in fünf strukturierten Schritten: Man müsse mit den Patienten über das Ziel und die Wege dorthin sprechen, Material aushändigen, bei einem (Online-)Folgetermin mögliche Fragen beantworten, die gemeinsame Entscheidung treffen und nach sechs Monaten reevaluieren.
Tipps fürs Gespräch
Im Positionspapier „Language Matters“ finden sich viele Tipps für eine bessere Gesprächsführung mit Patienten. Hier einige davon:
-
Sprechen Sie verständlich. Versuchen Sie, nicht zu viele Fachausdrücke zu verwenden. Achten Sie auf Worte und Formulierungen, die der Mensch mit Diabetes selbst verwendet, geben Sie diese Sprache wieder. Hinterfragen Sie, wo immer möglich, Annahmen, Verständnis und die Wirkung Ihrer Sprache auf eine Person.
-
Vermeiden Sie absolute und wertende Aussagen („Sie sind eigentlich zu alt für einen Typ-1-Diabetes.”). Verwenden Sie stattdessen zurückhaltendere und neutrale Formulierungen („In Ihrem Alter ist ein Typ-1-Diabetes eher unwahrscheinlich.”).
-
Versuchen Sie, nicht die Unterhal- tung zu dominieren, sondern gewähren Sie Ihren Patienten ausreichend Redezeit. Stellen Sie Fragen, versuchen Sie, mit Ihren Patienten zusammenzuarbeiten. Bleiben Sie stets gesprächsbereit („Haben Sie noch Fragen?”).
-
Unter keinen Umständen sollten Sie „drohen”, ein Ultimatum stellen oder Menschen einschüchtern, zum Beispiel mit Sätzen wie diesem: „In ähnlichen Fällen haben wir unseren Patienten auch schon mal die Pumpe wieder weggenommen.”
-
Insbesondere bei Bestehen von körperlichen oder psychischen Begleit- und Folgeerkrankungen des Diabetes sollten Sie sich um eine neutrale und ermutigende Sprache bemühen, die nicht wertet oder die Person und ihr Handeln herabwürdigt.
-
Wenn Sie Themen ansprechen möchten, die den Patienten möglicherweise unangenehm sind (z.B. erektile Dysfunktion, depressive Verstimmungen oder Übergewicht), dann fragen Sie freundlich, aber direkt, ob sie darüber reden möchten. Falls das nicht der Fall ist, respektieren Sie diese Entscheidung.
Um in diesen Prozess überhaupt eintreten zu können, dürfe aber keine Vorverurteilung à la „Statt Ihre Zeit mit Essen zu verbringen, sollten sie lieber mal nach draußen gehen“ stattfinden. Möchte der Patient etwas nicht umsetzen, weil seine Lebenssituation es nicht zulasse, sei dies in Ordnung. Bei anderer Gelegenheit habe er vielleicht einen freien Kopf für die Entscheidung. Über Risiken müsse man aufklären, ohne auf Abschreckung zu setzen.
In der medizinischen Sprache drücke sich oft ein veraltetes, paternalistisches Rollenverständnis aus, kritisiert der Psychologe Prof. Dr. Bernhard Kulzer. Das Patientenrechtegesetz stelle aber klar, dass nicht Ärzte, sondern die Betroffenen über die Therapie ihrer Erkrankung entscheiden. Mediziner sollen dabei informieren und unterstützen.
Patienten sind Experten ihrer Situation
Selbst das Passivkonstrukt „ein Patient wird behandelt“ sei in der Diabetologie nicht zutreffend – schließlich würden Menschen mit Diabetes ihre Therapie jeden Tag selbst umsetzen. Mediziner müssten dies wertschätzen und anerkennen, dass auch mal Schwierigkeiten auftreten können.
Für Patienten, die sich in einer konkreten Situation von der Wortwahl eines Arztes verletzt fühlen, haben die Experten einen Rat: Ruhig bleiben, den Standpunkt in Ich-Botschaften formulieren, die Praxis wechseln. Ein Arzt, der die Kritik nicht akzetieren könne, sei kein guter Ansprechpartner.
Medical-Tribune-Bericht