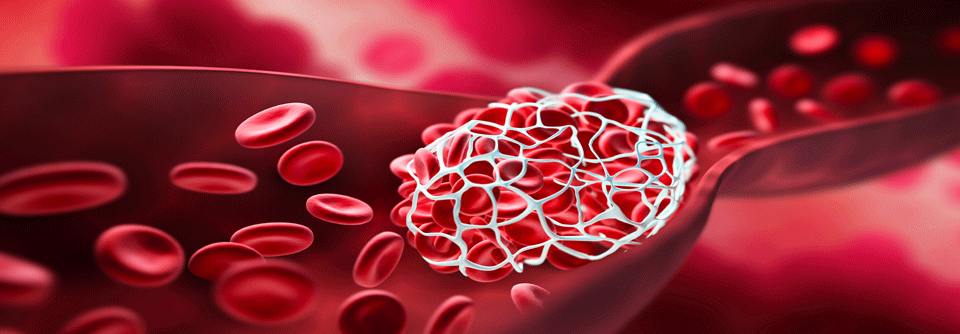Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom: Schlaganfall durch Autoimmunprozess
 Auch bei jungen Patienten können die Antikörper Thrombembolien fördern.
© iStock.com/Vadimguzhva
Auch bei jungen Patienten können die Antikörper Thrombembolien fördern.
© iStock.com/Vadimguzhva
Das Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom manifestiert sich vor allem in arteriellen und venösen thrombotischen Ereignissen sowie Sinusvenenthrombosen. Auslöser der Autoimmunerkrankung sind körpereigene spezifische Antiphospholipid-Antikörper. Binden diese an Beta2-Glykoproteine auf Zelloberflächen, wird über verschiedene Zwischenschritte das Komplementsystem aktiviert und thromboembolischen Prozessen Vorschub geleistet.
In der klinischen Praxis lässt sich ein Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom-assoziiertes arterielles oder venöses Ereignis bei ischämischem Schlaganfall oder transitorischer ischämische Attacke (TIA) allein von der Symptomatik her nicht von Ereignissen anderer Ätiologie unterscheiden, erklärt Privatdozent Dr. Thomas Seifert-Held von der Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Graz. Entsprechend schlecht ist auch die Studienlage zur Epidemiologie. In einer Metaanalyse aus dem Jahr 2013 wurden bei 13,5 % der Patienten mit ischämischem Schlaganfall oder TIA jeglichen Alters Antiphospholipid-Antikörper nachgewiesen.
Vor allem bei Jüngeren ohne weitere klassische Risikofaktoren sollte deshalb hieran gedacht werden – insbesondere wenn auch schon andere Autoimmunerkrankungen wie z.B. ein systemischer Lupus erythematodes bekannt sind. Betroffene Frauen haben nach zerebralem ischämischem Insult ein erhöhtes Risiko für Schwangerschafts- und andere gynäkologische Komplikationen. Fallberichte und Kleinserien berichten zudem über Assoziationen z.B. mit kognitiven Einschränkungen oder Krampfanfällen.
Akuttherapie wie beim ischämischen Insult
Die Diagnose des Antiphospholipid-Antikörper-Syndroms erfolgt durch mehrfache Serum-Antikörper-Bestimmungen über mindestens drei Monate. Der nur einmalige Nachweis von Antikörpern ist vermutlich nicht prädiktiv für das Auftreten ischämischer Rezidive. Die Akuttherapie unterscheidet sich nicht von der Standardtherapie eines ischämischen Schlaganfalls. In der Prophylaxe kommen Vitamin-K-Antagonisten, Thrombozytenfunktionshemmer und ggf. orale Antikoagulanzien zum Einsatz.
Quelle: Seifert-Held T. Z Gefässmed 2018; 15: 6-8