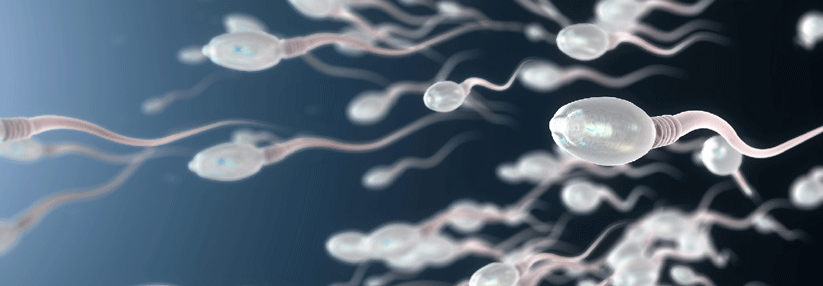Körperdysmorphe Störung Die Angst, entstellt zu sein
 Die Patienten verbringen oft Stunden vor dem Spiegel und trauen sich mit der Zeit immer seltener, das Haus zu verlassen. (Argenturfoto)
© Katarzyna Bialasiewicz Photographee.eu/Getty Images
Die Patienten verbringen oft Stunden vor dem Spiegel und trauen sich mit der Zeit immer seltener, das Haus zu verlassen. (Argenturfoto)
© Katarzyna Bialasiewicz Photographee.eu/Getty Images
Nahezu jeder hat einen Körperteil, den er an sich nicht so gerne mag. Bei der körperdysmorphen Störung – auch „Entstellungsangst“ genannt – ist diese Empfindung jedoch ins Extreme gesteigert. Ständig kreisen die Gedanken um den vermeintlichen Makel, die Betroffenen beschäftigen sich stundenlang damit und versuchen, fragliche Stellen zu verstecken.
Die Selbstzweifel beziehen sich bei beiden Geschlechtern häufig auf die Haut oder die Nase. Frauen mit körperdysmorpher Störung hadern zudem häufig mit der Brust oder dem Bauch, während Männer sich eher exzessiv Sorgen um ihre Körpergröße, ihre Muskelmasse, die Kieferpartie oder die Genitalien machen.
Eine psychische Erkrankung liegt vor, wenn die Betroffenen im Alltag einen starken Leidensdruck verspüren, erklärt Dr. Marie Drüge von der Universität Zürich im Podcast O-Ton Allgemeinmedizin. Zum Teil nutzen die Patienten exzessiv Make-up, verlassen ihre Wohnung erst nach aufwendigen Ritualen, nur bei bestimmten Lichtverhältnissen oder gar nicht. Manche können deshalb nicht mehr zur Schule oder zur Arbeit gehen.
Wird die Störung beizeiten erkannt, ist sie Dr. Drüge zufolge in vielen Fällen gut therapierbar. Behandlung der ersten Wahl ist eine kognitive Verhaltenstherapie. Die Betroffenen vertrauen sich aus Angst und Scham jedoch oft lange niemandem an. Es drohen eine Chronifizierung und schwerwiegende Krankheitsfolgen. Hausärzten komme dabei eine wichtige Rolle zu, stellt Dr. Drüge fest: Eine langjährige Vertrauensbasis ermögliche es ihnen manchmal zu bemerken, wenn Patienten sich verändern, einen starken Leidensdruck oder eine komorbide Depression entwickeln.
Einfache Screeningfragen im Patientenkontakt
Manchmal fragen Betroffene direkt, ob „das eigentlich noch normal ist“, wie ihre Nase oder ihr Kiefer aussieht. Umgekehrt lassen sich einfache Screeningfragen einsetzen, etwa:
- Machen Sie sich Sorgen um Ihr Aussehen?
- Haben Sie diese Sorgen zu irgendeiner Zeit beunruhigt?
- Beeinträchtigen Sie diese Sorgen in Ihrem Alltag?
Einige Betroffene fallen durch den Wunsch nach vielen Schönheits-OPs auf. In der ästhetischen Chirurgie finden sich Dr. Drüge zufolge Prävalenzen von 10–20 %. „Rekordhalterin“ in ihrer Praxis war eine Patientin, die sich schon 28-mal die Nase hatte operieren lassen. Weigern sich Ärzte am Wohnort, einen Eingriff durchzuführen, gehen viele den Weg ins Ausland. Zufriedenheit mit dem Resultat einer Schönheits-OP stellt sich jedoch selten ein. Und wenn doch, wechselt die Störung oft nur den Ort: Die Sorgen kreisen dann um einen anderen Körperteil.
Auf diese Weise bringt die körperdysmorphe Störung handfeste gesundheitliche Risiken mit sich. Neben unerwünschten Effekten von Schönheits-OPs – die Patientin mit der häufigen Nasenkorrektur hatte etwa starke Knorpelschäden davongetragen – sind auch Selbstoperationen ein Thema. Die Betroffenen versuchen, sich mit Schmirgelpapier die Zähne weiß zu schleifen, oder sie wollen Knubbel auf der Haut mit einer Schere abschneiden. Auch die Suizidalität ist stark erhöht.
Häufig wird ein gesteigerter Druck durch die Medien, bestimmten ästhetischen Normen zu entsprechen, mit der körperdysmorphen Störung in Verbindung gebracht. Zwar ist das Krankheitsbild deutlich älter als Instagram & Co., erstmals beschrieben wurde es 1886. Dennoch bemerkt auch Dr. Drüge einen wachsenden Einfluss des Internets. So berichten ihre Patientinnen häufig, dass sie viel Zeit mit Social Media verbringen, dies aber negative Gefühle verursache.
Wie groß genau der Einfluss sozialer Medien auf die Störung ist, wird noch diskutiert, erklärt die Forscherin. Metaanalysen belegen zumindest eine negative Korrelation zwischen der Social-Media-Nutzung und dem psychischen Wohlbefinden.
KI-Filter, die Falten und Makel retuschieren, verschärfen das Problem. Wollten Patienten früher wie Models in Magazinen oder auf Plakaten aussehen, haben viele heute ein mit Filtern verändertes Selfie als Idealbild dabei. Aufklärungskampagnen in Schulen könnten der Expertin zufolge ebenso helfen wie eine Pflicht, bearbeitete Bilder im Netz zu kennzeichnen – in Norwegen besteht diese seit 2021.
Quelle: Medical-Tribune-Bericht
Mehr zum O-Ton Allgemeinmedizin
O-Ton Allgemeinmedizin gibt es alle 14 Tage donnerstags auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten zum Umgang mit besonders anspruchsvollen Situationen in der Praxis.