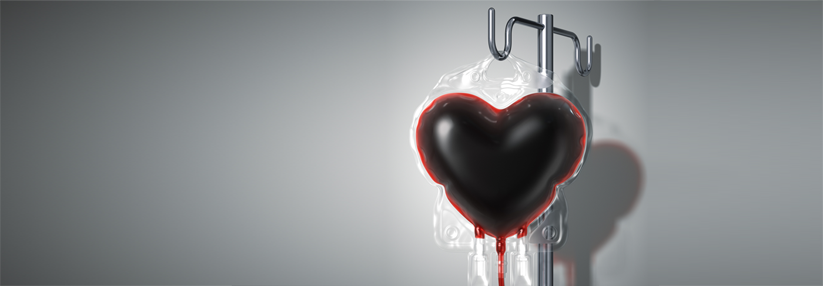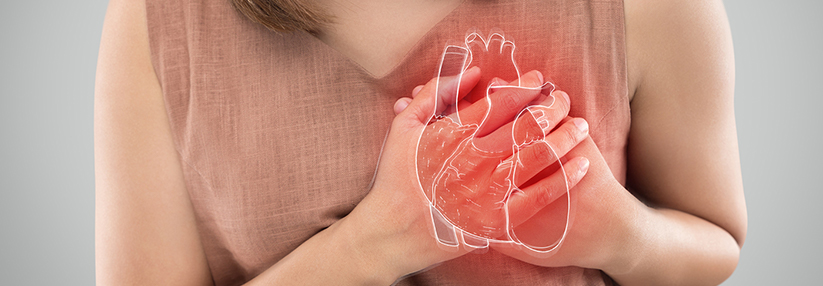Herzinfarkt: Frauen schlechter versorgt Frauenherzen ticken anders – und das wird zum Problem
Kardiovaskuläre Erkrankungen werden bei Frauen noch immer zu wenig erkannt und beachtet. Die Gründe dafür sind vielfältig, schreibt Dr. Lena Seegers vom Women’s Heart Health Center Frankfurt. Um die schlechtere Versorgung zu verbessern, ist es aus ihrer Sicht erforderlich, zu verstehen,
- wie Frauen- sich von Männerherzen unterscheiden,
- wie sich Infarkte bei Patientinnen klinisch präsentieren und
- was das für eine angepasste Diagnostik und Therapie bedeutet.
Denn ein Frauenherz ist nicht einfach ein kleineres Männerherz, stellt die Autorin klar. Das Problem beginne mit dem mangelnden Bewusstsein dafür, dass kardiale Erkrankungen auch beim weiblichen Geschlecht die häufigste Todesursache sind.
Frauen mit Herzinfarkt weisen oft mehrere Beschwerden gleichzeitig auf. Dazu gehören Brust-, Schulter-, Bauch- und Armschmerzen sowie Dyspnoe und Schwindel. Ergänzend können Rücken- und Kieferschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen, Angstzustände sowie ausgeprägte Müdigkeit hinzukommen. Der Brustschmerz wird nicht unbedingt wie bei Männern als belastungsabhängiges retrosternales Druckgefühl mit Ausstrahlen in den linken Arm beschrieben, z. T. kann er sogar fehlen. Als „atypisch“ sollte er deshalb aber nicht bezeichnet werden. Zudem kommunizieren Frauen anders als Männer. Sie schildern Symptome mitunter emotionaler und ausführlicher. All dies kann dazu beitragen, dass weder die betroffene Patientin noch das ärztliche Personal frühzeitig den richtigen Verdacht schöpfen.
Vorteil in den USA
Die Mortalität aufgrund von kardiovaskulären Erkrankungen konnte bei Frauen in den USA deutlich reduziert werden. Einen wichtigen Beitrag haben spezielle Frauenherzzentren – Women’s Heart Center – geleistet, erklärt Dr. Seegers. Die interdisziplinären Zentren sind spezialisiert auf die geschlechterspezifischen Besonderheiten kardialer Erkrankungen. Das Konzept umfasst Behandlung und Wahrnehmung ebenso wie Forschung, Schulungen und akademische Ausbildung. Nach Meinung der Autorin sollten solche Zentren auch in Deutschland flächendeckend etabliert werden. Wie deren Zukunft in den USA aussieht, bleibt abzuwarten.
Für die Risikoabschätzung ist eine Reihe von geschlechtsspezifischen Faktoren essenziell, betont die Expertin, darunter insbesondere der menopausale Status. Denn während Frauen vor der Menopause kaum klinisch symptomatische Atherosklerosen aufweisen, nimmt das Risiko danach erheblich zu. Das heißt: Je früher die Wechseljahre eintreten, desto höher ist später das Risiko z. B. für einen Herzinfarkt. Das biologische Alter liegt mit früher Menopause durchaus höher als das chronologische.
Ein polyzystisches Ovar oder ein Gestationsdiabetes führen zu einem Anstieg des späteren kardiovaskulären Risikos. Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen wie ein sich verschlechternder chronischer Hypertonus, eine Präeklampsie oder Eklampsie erhöhen ebenfalls die Gefahr. Diese Krankheiten gilt es anamnestisch zu erfragen. Klassische kardiovaskuläre Risikofaktoren sind bei Frauen anders zu gewichten, so Dr. Seegers. Das betrifft insbesondere Diabetes mellitus und Rauchen. Beide lassen das Risiko stärker anwachsen als bei Männern. Außerdem erreichen Frauen vor allem nach der Menopause seltener die Zielwerte für Blutdruck und LDL-Cholesterin.
Keine Obstruktion in der Angiografie zu sehen
Auch in der Diagnostik gibt es besonderheiten. Bei Patientinnen mit Angina pectoris zeigt sich in der Koronarangiografie in rund zwei Drittel der Fälle keine Obstruktion. Zugleich entdeckt man bei Stenosen von unter 50 % mittels intrakoronarer Bildgebung in bis zu 79 % der Fälle atherosklerotische Plaques, erläutert die Autorin. Insbesondere nach der Menopause nimmt die Plaquevulnerabilität zu.
Bei Frauen wird doppelt so häufig die Arbeitsdiagnose Myokardinfarkt ohne obstruktive Atherosklerose (myocardial infarction with no obstructive coronary artery disease, MINOCA) gestellt. Differenzialdiagnosen bei Brustschmerzen umfassen die koronare Mikrozirkulationsstörung, die Frauen häufiger betrifft, die Takotsubo-Kardiomyopathie und die Spontandissektion.
Quelle: Seegers LM. Hessisches Ärzteblatt 2025; 86: 94–99