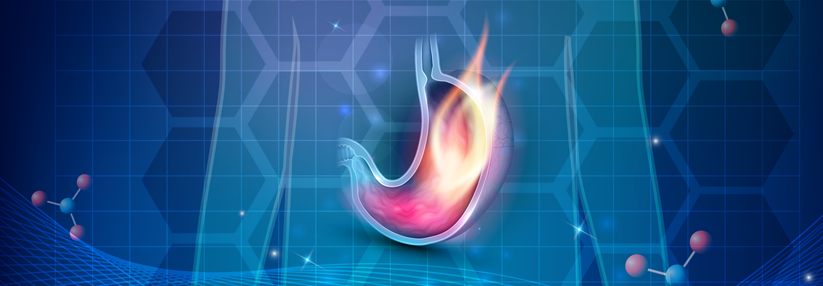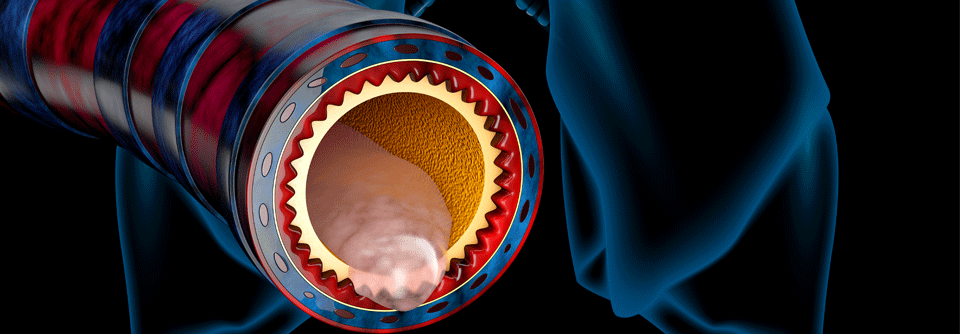Embolie statt Exazerbation: Bei COPD-Patienten mit verstärkten Beschwerden genau hinschauen!
 Bei etwa jedem 20. COPD-Patienten mit stationär behandlungsbedürftiger akuter Verschlechterung der respiratorischen Situation liegt eine Lungenembolie vor. (Agenturfoto)
© iStock/mustafagull
Bei etwa jedem 20. COPD-Patienten mit stationär behandlungsbedürftiger akuter Verschlechterung der respiratorischen Situation liegt eine Lungenembolie vor. (Agenturfoto)
© iStock/mustafagull
Ihr COPD-Patient hustet seit Kurzem verstärkt und bekommt deutlich schlechter Luft – ganz klar eine Exazerbation? Solch ein diagnostischer Schnellschuss kann nach hinten losgehen, vor allem wenn sich eine Embolie hinter den Symptomen versteckt. Bei etwa jedem zwanzigsten COPD-Patienten mit einer stationär behandlungsbedürftigen akuten Verschlechterung der respiratorischen Situation liegt eine Lungenembolie vor. Zu diesem Ergebnis kommt eine von französischen Wissenschaftlern um Professor Dr. Francis Couturaud vom Département de Médecine Interne et Pneumologie der Universität Brest initiierte Querschnittstudie.
Von insgesamt 2268 konsekutiven, stationär aufgenommenen Exazerbationspatienten erfüllten nur 750 die Selektionskriterien der Studie (u.a. keine Langzeitantikoagulation). Ausgewertet wurden schließlich die Daten von 740 Kranken. Bei denjenigen mit einer hohen klinischen Wahrscheinlichkeit für eine Lungenembolie (Geneva-Score ≥ 11) hatte man innerhalb von 48 Stunden eine pulmonale Angiographie mittels Spiral-CT sowie eine Beinvenensonographie durchgeführt. In den übrigen Fällen bestimmte das Team zunächst die D-Dimere und leitete – je nach Ergebnis – weitere diagnostische Schritte ein.
Was zur respiratorischen Verschlechterung geführt hat
- bakterielle bronchiale Infektion (n = 462)
- Pneumonie (n = 69)
- Ateminsuffizienz unbekannter Ursache (n = 69)
- Lungenembolie (n = 44)
- Linksherzinsuffizienz (n = 42)
- tiefe Beinvenenthrombose (n = 10)
- Krebserkrankung (n = 10)
- Vorhofflimmern (n = 4)
- Pneumothorax (n = 2)
Autorin: Dr. Judith Lorenz
Quelle: Couturaud F et al. JAMA 2021; 325: 59-68; DOI: 10.1001/jama.2020.23567
INTERVIEW: Professor Dr. Claus Vogelmeier
(Universitätsklinikum Marburg)
Interview: Manuela Arand