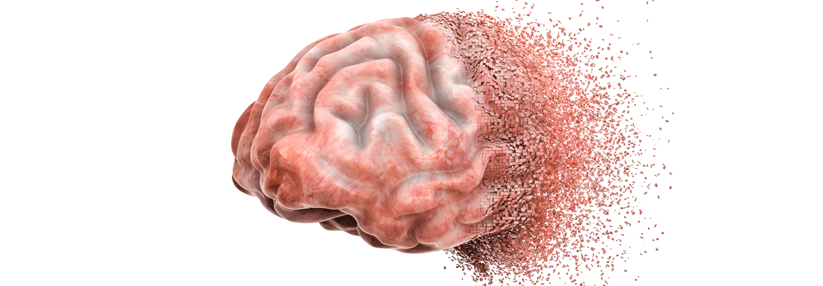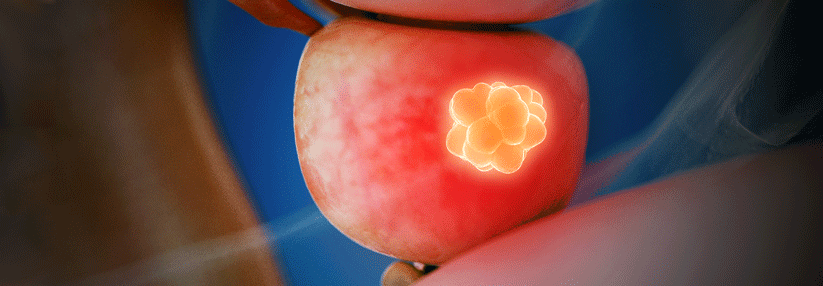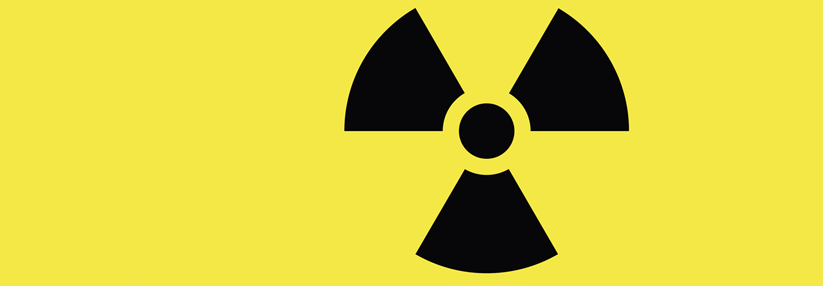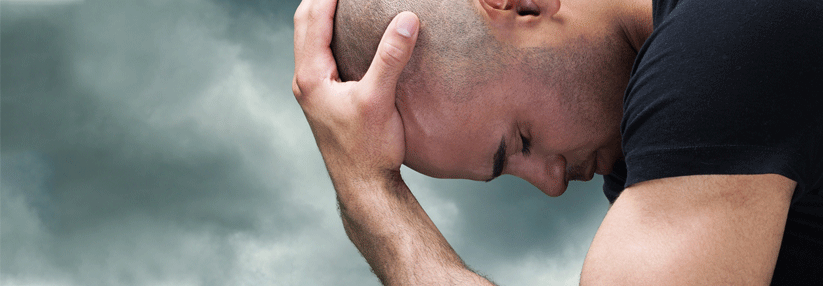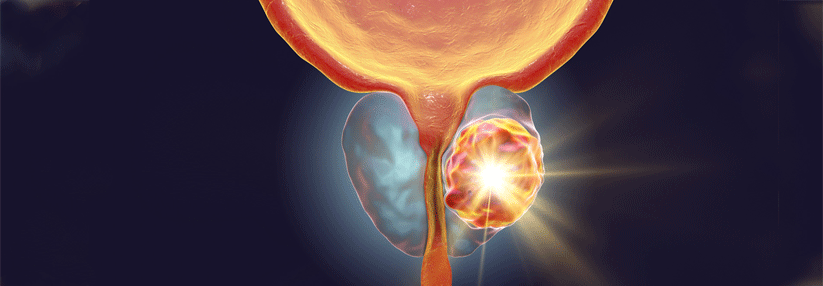
Prostatakarzinom Frühe Toxizitäten nach RT erhöhen Risiko von Spätkomplikationen
 Frühe und späte Nebenwirkungen der Radiotherapie bei Prostatakarzinomen stehen offenbar in Verbindung.
© luismolinero – stock.adobe.com
Frühe und späte Nebenwirkungen der Radiotherapie bei Prostatakarzinomen stehen offenbar in Verbindung.
© luismolinero – stock.adobe.com
Während akute Toxizitäten nach einer Radiotherapie der Prostata wohl auf direkter Zellschädigung beruhen, gehen späte Toxizitäten vermutlich auf Fibrose und chronische Entzündungsprozesse zurück. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen beiden Prozessen besteht, war bisher allerdings unzureichend untersucht. Forschende um Dr. John Nikitas, University of California, Los Angeles, werteten dazu nun individuelle Patient:innendaten aus sechs Phase-3-Studien mit einem medianen Follow-up von 72 Monaten aus.
Die Kolleg:innen berücksichtigten für ihre Metaanalyse 6.593 Personen (medianes Alter 69 Jahre), die wegen eines Prostatakarzinoms eine definitive Radiotherapie erhielten. Knapp zwei Drittel von ihnen waren konventionell fraktioniert bestrahlt worden, der Rest moderat hypofraktioniert. Das Team adjustierte für Alter, Androgendeprivation, Art der Radiotherapie sowie Dosis und Zeitplan der Bestrahlungen.
29,8 % der Erkrankten erlitten akute Toxizitäten des Grads ≥ 2 im Urogenitaltrakt, definiert als Nebenwirkungen, die bis zu drei Monate nach Behandlungsende auftraten. 15,4 % entwickelten späte Beschwerden des gleichen Schweregrads. Die Raten gastrointestinaler Toxizitäten vom Grad 2 oder höher fielen in beiden Phasen recht ähnlich aus (akut 14,7 %; spät 14,3 %). Bei den Betroffenen, für die entsprechende Daten vorlagen, traten späte Komplikationen beider Organsysteme zu gut 95 % erstmals mehr als sechs Monate nach Behandlungsende auf.
Frühe Toxizitäten und Spätfolgen
Frühe Toxizitäten im GU-Trakt korrelierten signifikant mit der Wahrscheinlichkeit, dort späte Komplikationen zu entwickeln (Grad ≥ 2; Odds Ratio [OR] 2,20; 95%-KI 1,88–2,57; p < 0,0001). Nach fünf Jahren betrug das kumulative Risiko 12,5 % verglichen mit 7,5 % für diejenigen, die in der Akutphase niemals urogenitale Beschwerden aufwiesen (p < 0,0001). Ähnliches galt auch für gastrointestinale Spätfolgen der RT (OR 2,53; 95%-KI 2,07–3,08; p < 0,0001). Die kumulative Fünf-Jahres-Inzidenz lag hier bei 21,5 % nach vorheriger GI-Akuttoxizität vs. 12,5 % ohne (p < 0,0001).
Bei Patient:innen mit akuten urogenitalen oder gastrointestinalen Toxizitäten verschlechterten sich zudem selbstberichtete Indikatoren der organbezogenen Lebensqualität wahrscheinlicher signifikant (GU-Trakt OR 1,41; p = 0,0002; GI-Trakt OR 1,52; p < 0,0001). Insgesamt zeigten im Verdauungssystem 31,3 % aller Erkrankten klinisch relevante Einbußen an Lebensqualität, im Urogenitaltrakt immerhin 19,5 %.
Die Autor:innen sehen Anlass, weitere Forschung in diesem Bereich zu betreiben. Dies betrifft unter anderem die Frage, ob präventive Strategien gegen frühe Toxizitäten sich auch auf späte Beschwerden positiv auswirken. Dazu zählen beispielsweise eine MRT-gestützte Reduktion der Sicherheitsränder, Aussparung der Urethra und die Nutzung perirektaler Spacer. Auch bleibt unklar, wie eine frühzeitige Behandlung akuter Nebenwirkungen die Rate später Toxizitäten beeinflusst.
Quelle:
Nikitas J et al. Lancet Oncol 2025; DOI: 10.1016/S1470-2045(24)00720-4