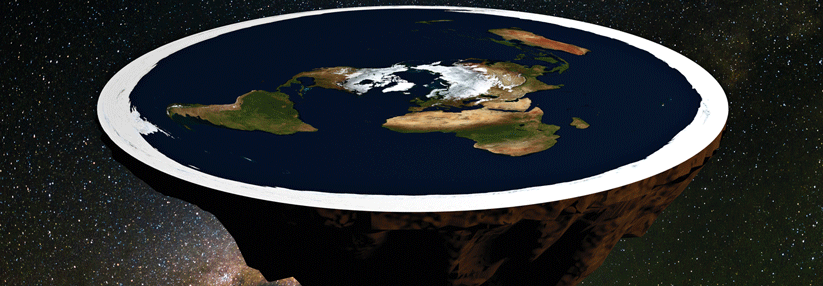„Homöopathie verstößt gegen das oberste ärztliche Gebot“
 Alles Hokuspokus: Die Wirkung von Schüsslersalzen, Globuli und Co. bleibt nach wie vor aus.
© Friedrich Images – stock.adobe.com
Alles Hokuspokus: Die Wirkung von Schüsslersalzen, Globuli und Co. bleibt nach wie vor aus.
© Friedrich Images – stock.adobe.com
Schon die Geburtsstunde der Homöopathie war in wissenschaftlicher Hinsicht keine Glanzleistung. Der Begründer der Lehre, Samuel Hahnemann, hatte 1790 in einem Selbstversuch Chinarinde eingenommen. Aus der Tatsache, dass er als vermeintlich Gesunder bei sich Malariasymptome bemerkte, schloss er, dass Ähnliches auch für andere Stoffe gelte: Wie die Chinarinde helfen sie beim Kranken genau gegen die Symptome, die sie bei einem Gesunden hervorrufen. Damit war die Ähnlichkeitsregel, das erste Behandlungskonzept der Homöopathie, gefunden.
Nur leider fiel den Nachfolgern Hahnemanns auf, dass sich der Versuch nicht wiederholen ließ, berichten Dr. Christian Keinki von der Medizinischen Klinik II der Uniklinik Jena und seine Mitautoren. „Warum Hahnemann diese Symptome entwickelte, ist heute nicht mehr zu ermitteln.“ Als mögliche Ursache des Beschwerdebilds kämen zum Beispiel eine allergische Reaktion, eine frühere Malariainfektion oder eine virale Krankheit infrage. Die Heilkraft der Chinarinde hatte mit dem Fieber jedenfalls nichts zu tun.
Seitdem sind viele in Hahnemanns „wissenschaftliche“ Fußstapfen getreten. Bei den Untersuchungen mit unzureichender Evidenz aus niedrigen Klassen – Fall-Kontroll-Studien beispielsweise oder Fallserien – ist jedenfalls kein Mangel festzustellen. Ihr Wert für die Bildung von Hypothesen und die Planung von kontrollierten Studien ist laut den Autoren nicht zu bestreiten. Ein Wirksamkeitsnachweis seien diese Untersuchungen aber nicht.
Werden Verunreinigungen ebenfalls potenziert?
Echte Belege könnten nur hochwertige randomisierte, kontrollierte Untersuchungen liefern oder die Auswertung der gesamten Datenlage durch Metaanalysen und Reviews. Und die kommen laut Dr. Keinki zu einem eindeutigen Befund: Es gibt kein Krankheitsbild, bei dem die Homöopathie sinnvoll angewendet werden könnte. „Gute Studien mit ausreichender Teilnehmerzahl kommen durchweg zu dem Ergebnis, dass es keinen signifikanten Vorteil gegenüber Placebo gibt.“
Dazu kommen logische Ungereimtheiten. So stellt sich beim zweiten Grundprinzip der Homöopathie, der Potenzierung, die Frage, wie ein Mittel pharmakologische Wirkung entfalten soll, das eigentlich nicht im fertigen Präparat enthalten ist. Selbst bei niedrigen Potenzen, beispielsweise D6, nehmen Patienten bei regelkonformer Einnahme – 15 Globuli pro Tag – nur 0,015 mg der Urtinktur zu sich, wundern sich die Autoren. Je nach Mittel und Herstellung seien spätestens ab einer Potenz von D23 bzw. C12 überhaupt keine Bestandteile des Ausgangsmaterials mehr in den Präparaten zu finden.
Alternative Erklärungsmodelle wie Energie- und Informationsübertragung durch Biophotonen, Nanopartikel oder die Konfiguration von Wassermolekülen vermögen wissenschaftlich nicht zu überzeugen. Für keine dieser Wirkhypothesen existieren valide bestätigte Versuchsergebnisse. Auch die Quantenphysik hilft da nicht aus der Patsche, lässt sie sich doch nur auf Vorgänge im subatomaren Bereich anwenden.
Die Risiken des Nichts
Globuli sind teurer als konventionelle Therapien
Eine Auswertung von Routinedaten konnte zeigen: Patienten, die im Rahmen der gesetzlichen Kassenversorgung Homöopathie in Anspruch nehmen, sind teurere Versicherte als Patienten, die ausschließlich konventionell behandelt werden. Das Fazit von Dr. Keinki und Kollegen ist eindeutig: „Es ist ethisch geboten, dass jede Therapie zweifelsfrei einen Nutzen nachweisen kann und zudem Sicherheit und Qualität belegt sind.“ Behandlungen mit einem potenziell negativen Nutzen-Risiko-Verhältnis wie die Homöopathie verstießen deshalb gegen das oberste ärztliche Gebot, keinen Schaden anzurichten. Warum also gelte für die alternative Therapieform der gesetzliche Schutz der besonderen Therapierichtung?Quelle: Keinki C et al. klinikarzt 2019; 48: 12-17