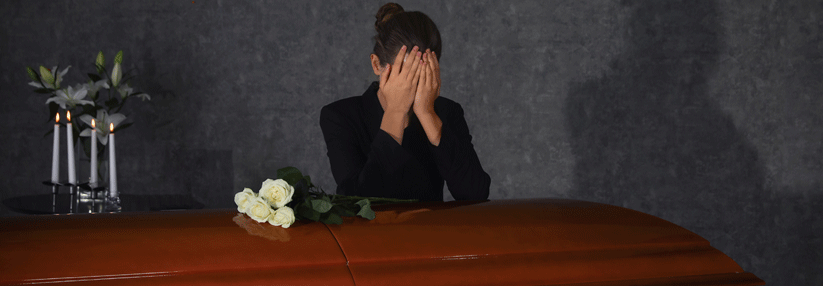Wenn der Kummer nicht vergeht Neue ICD-11-Kriterien erleichtern Diagnose und Therapie der pathologischen Trauer
 Manche Hinterbliebenen mit anhaltender Trauer erleben intensive Emotionen, andere sind über Monate wie versteinert.
© eyetronic – stock.adobe.com
Manche Hinterbliebenen mit anhaltender Trauer erleben intensive Emotionen, andere sind über Monate wie versteinert.
© eyetronic – stock.adobe.com
Der Verlust eines geliebten Menschen löst eine natürliche Trauerreaktion aus. In den ersten Wochen nach dem Schock durchlaufen Trauernde oft Phasen von erhöhtem Stress und Verleugnung. Viele von ihnen berichten von einer über Monate andauernden starken Erschöpfung, die selbst leichte Tätigkeiten zum Kraftakt werden lässt.
All dies ist völlig normal. Doch während die meisten Menschen irgendwann aus dem akuten Trauerprozess in den Alltag zurückfinden, kann sich dieser Vorgang bei einigen verkomplizieren und zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Das wird als „anhaltende Trauerstörung“ bezeichnet und ist seit Kurzem in der ICD-11 unter dem Code 6B42 als Diagnose erfasst.
Die Trauerstörung kann diagnostiziert werden, wenn durch den Verlust eines nahestehenden Menschen eine tiefgreifende Trauerreaktion auftritt, die z.B. mit Schuldgefühlen, Wut oder Verleugnung einhergeht. Manche Betroffene leiden intensiv, andere empfinden dagegen eine Gefühlstaubheit. Viele fühlen sich so, als hätten sie einen Teil ihres eigenen Selbst verloren, und vernachlässigen gewohnte soziale Aktivitäten.
Die genannten Symptome können kurzfristig auch bei einem normalen Trauerverlauf auftreten. Als pathologisch angesehen werden sie erst, wenn sie die erwarteten kulturellen Normen der betroffenen Person deutlich übersteigen und mindestens ein halbes Jahr lang persistieren, erklärt Prof. Dr. Birgit Wagner von der Medical School Berlin. Im Klassifikationssystem DSM-5-TR müssen die Symptome dagegen nach dem Verlust des Angehörigen mindestens zwölf Monate lang bestehen.
Zwischen Trennungsschmerz und schönen Erinnerungen
Die anhaltende Trauerstörung umfasst einige Beschwerden, die einer Depression ähneln, weshalb die beiden Störungen oft verwechselt werden. Bei genauerer Betrachtung lassen sich jedoch Unterschiede erkennen: Bei Trauerpatienten tritt der Trennungsschmerz oft im Wechsel mit positiven Gefühlen und schönen Erinnerungen auf, während eine depressive Episode meist gleichförmiger verläuft. Menschen mit Depression können sich häufig nicht auf emotionale Beziehungen zu anderen Personen einlassen, womit Trauernde keine Schwierigkeit haben. Schuldgefühle stehen bei der anhaltenden Trauerstörung meist im Bezug zum Verstorbenen („Warum konnte ich den Tod nicht verhindern?“), was bei Depression nicht der Fall sein muss.
Auch die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) weist Ähnlichkeiten zur pathologischen Trauer auf. In beiden Fällen findet sich ein auslösendes, einschneidendes Ereignis. Aber während Personen mit PTBS traumaassoziierte Reize vermeiden, wollen Trauerpatienten auch den Trennungsschmerz selbst unterdrücken – aus Angst, vor Kummer „verrückt zu werden“. PTBS-Betroffene leiden oft an Flashbacks und Albträumen, Leidensgenossen mit anhaltender Trauer dagegen haben auch positive intrusive Erinnerungen. Außerdem fehlt ihnen die von der Traumatisierung bekannte Hypervigilanz mit unter anderem Schreckhaftigkeit und Konzentrationsschwäche. Auch eine Komorbidität von PTBS und Trauerstörung ist möglich.
Als Risikofaktoren für pathologische Trauer gelten ein unerwartetes bzw. plötzliches Versterben, traumatische oder gewaltsame Umstände (Unfall, Tötungsdelikt, Suizid). Auch wer das eigene Kind oder den Lebenspartner verliert, ist stärker gefährdet.
Der Stellenwert psychotherapeutischer Verfahren bei der Behandlung wurde inzwischen in zahlreichen Studien untersucht. Eine Metaanalyse fand einen eher schwachen, aber signifikanten Effekt. Am meisten profitierten Patienten, die im individuellen Setting behandelt wurden und schwerere Symptome aufwiesen.
Für die Gruppenbehandlung von komplizierter Trauer fand sich in einer weiteren Übersichtsarbeit nur ein schwacher Effekt, der in der Nachbeobachtung keinen Bestand hatte. Diese Form der Trauerbewältigung wird in Deutschland am häufigsten angeboten und empfohlen, insbesondere im Selbsthilfe- und im karitativen Bereich.
Webbasierte Schreibtherapie mit signifikanten Effekten
Einige digitale Angebote sind ebenfalls gut evaluiert. Eine von Prof. Wagner entwickelte internetbasierte Schreibtherapie erzielte signifikante Verbesserungen mit moderaten bis großen Effektstärken, die auch nach eineinhalb Jahren noch aufrecht-erhalten blieben. Inzwischen kann also eine Reihe von evidenzbasierten Optionen für die anhaltende Trauerstörung empfohlen werden, lautet das Fazit der Autorin.
Quelle: Wagner B. DNP 2024; 25: 55-61