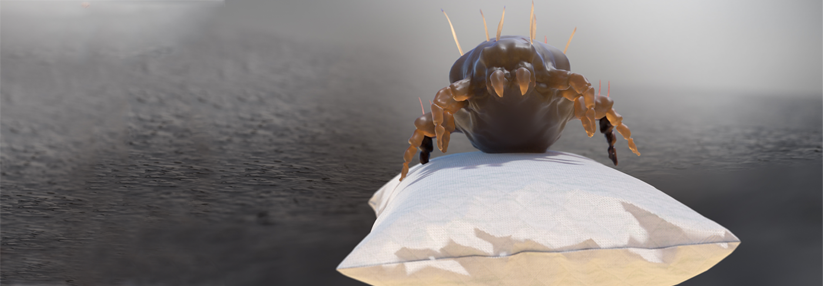Schlaf außer Rand und Band Orexin rückt in den Fokus neuer Therapieansätze für Narkolepsie
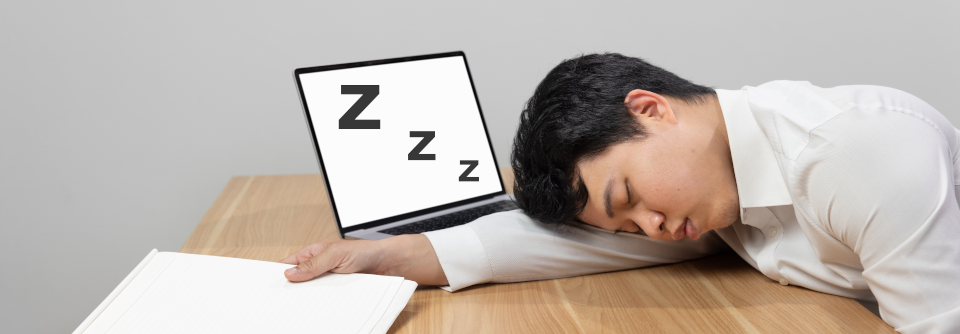 Ursächlich für den Untergang der orexinproduzierenden Neuronen könnten autoimmune Prozesse sein.
© toa555 – stock.adobe.com
Ursächlich für den Untergang der orexinproduzierenden Neuronen könnten autoimmune Prozesse sein.
© toa555 – stock.adobe.com
Eine Narkolepsie Typ 1 zeichnet sich durch das Auftreten von Kataplexien und den Mangel an Orexin im Liquor aus. Betroffen sind europaweit 20 bis 50 von 100.000 Personen. Die Erkrankung beginnt meist in der Pubertät oder im frühen Erwachsenenalter. Die anfangs vorrangig bestehende Müdigkeit bzw. der imperative Schlafdrang werden häufig als Müdigkeitssyndrom, Depression oder Aufmerksamkeitsstörung fehldiagnostiziert. Betroffene erhalten daher oft erst fünf bis zehn Jahre nach Symptombeginn die korrekte Diagnose.
Begleitend zu den charakteristischen Kataplexien kommt es u. a. zu
- gestörtem Nachtschlaf,
- Trugwahrnehmungen beim Einschlafen und Aufwachen,
- Gewichtszunahme,
- Konzentrationsstörungen,
- Depression oder Angststörungen.
Diagnostisch wegweisend sind klinische und schlafmedizinische Untersuchungen. Die erweiterte Labordiagnostik sowie eine Schädel-MRT sind im Rahmen der Ausschlussdiagnostik von Bedeutung. Hilfreich kann zudem eine Liquoruntersuchung auf das Vorhandensein von Orexin sein, erläutern Prof. Dr. Ulf Kallweit und Prof. Dr. Thomas Dittmar, beide von der Universität Witten/Herdecke.
In der Therapie lohnt ein multimodales Vorgehen
Die Therapie umfasst regelmäßige Schlafenszeiten und geplante Nickerchen am Tag, angemessene körperliche Aktivität sowie eine kohlenhydrat- und alkoholarme Kost. Gegebenenfalls sind Medikamente angebracht, um die Wachheit zu fördern oder die Kataplexie zu mindern. Natriumoxybat etwa lindert alle Hauptsymptome der Typ-1-Narkolepsie. Mitunter ist eine kognitive Verhaltenstherapie hilfreich.
Derzeit wird der Einsatz von Orexin-Rezeptoragonisten geprüft. Grundlage dieser Therapieoption sind Erkenntnisse zur Pathogenese der Typ-1-Narkolepsie. Rund 90 % der Betroffenen weisen einen Verlust von orexinproduzierenden Neuronen im Bereich des Hypothalamus auf. Identifiziert wurden zwei verschiedene Typen dieser Rezeptoren, die Orexin A und/oder Orexin B binden. Über verschiedene Neurotransmitter hat Orexin eine zentrale Bedeutung für die Regulierung von Schlaf- und Wachzuständen. Es spielt aber auch eine Rolle für die Nahrungsaufnahme sowie für verschiedene kardiovaskuläre, gastrointestinale und neuroendokrine Vorgänge. Neben den orexinproduzierenden Neuronen sind weitere Auffälligkeiten im ZNS bekannt.
Ursächlich für den Untergang der orexinproduzierenden Neuronen könnten autoimmune Prozesse sein. Zu dieser Hypothese passt das gehäufte Auftreten der Typ-1-Narkolepsie nach durchgemachter Infektion mit dem Influenza-A-Virus H1N1 (Schweinegrippe) bzw. nach einer H1N1-Impfung. Die genaue Pathogenese ist unklar, entsprechende Autoantikörper wurden bislang nicht gefunden. Auch eine Fehlregulation von Immunzellen (zum Beispiel CD4+) könnte eine Rolle spielen. Diskutiert wird ein Multiple-Hit-Modell, demzufolge es bei genetischer Prädisposition spezieller Auslöser bedarf, etwa einer Virusinfektion. Molekulargenetisch von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Subtyp DR2 der HLA-Klasse II, der bei allen Betroffenen vorliegt. Am häufigsten ist HLA-DQB1*06:02 zu finden, was allein genommen für die Entwicklung der Krankheit aber nicht ausreicht. Neben der Hypothese einer autoimmunen Genese wäre auch möglich, dass die orexinproduzierenden Neuronen durch Hypermethylierung epigenetisch blockiert werden. Das würde weitere Therapieoptionen eröffnen.
Quelle: Kallweit U, Dittmar T. Somnologie 2025; DOI: 10.1007/s11818-025-00494-7