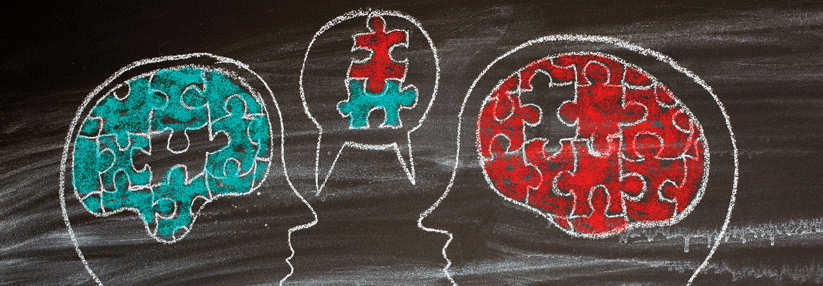AID-Systeme Universalwaffe gegen die Tücken des Diabetesalltags?
 Wie hilfreich sind AID-Systeme für Menschen mit Typ-1-Diabetes bei der korrekten Berechnung von Insulindosen?
© lukszczepanski – stock.adobe.com
Wie hilfreich sind AID-Systeme für Menschen mit Typ-1-Diabetes bei der korrekten Berechnung von Insulindosen?
© lukszczepanski – stock.adobe.com
Natürlich müssen nicht alle Menschen mit Typ-1-Diabetes AID-Systeme nutzen, um akzeptable Therapieergebnisse zu erzielen. Das weiß auch Dr. Sandra Schlüter, Diabetologin aus Northeim und Vorstandsmitglied der AG Diabetes & Technologie (AGDT), die das Symposiums veranstaltet hat. Dennoch begann Dr. Schlüter mit einem klaren Plädoyer für die Automatisierung. Denn Studien zufolge benötigen bis zu 60 % der Personen Hilfe bei der korrekten Berechnung von Insulindosen. Erfahrungsgemäß täten sich viele schwer damit, den Kohlenhydrat-, Fett- und Proteingehalt der Nahrung abzuschätzen, zwischen Kohlenhydrat- und Korrekturfaktoren zu unterscheiden und auch noch Einflussfaktoren wie Insulinwirkdauer, aktives Insulin, Injektionszeitpunkt und körperliche Aktivität in ihre Überlegungen einzubeziehen.
Wird schon passen: nach jeder Mahlzeit pauschal fünf Einheiten
„Die Leute wissen durchaus, dass sie oft zu spät oder auch zu früh Insulin spritzen oder sogar mal eine Insulingabe vergessen – doch so etwas passiert im Alltag nun einmal“, betonte Dr. Schlüter. Es gebe zwar zusätzlich zum gängigen Informationsmaterial mittlerweile sogar Tabellen zur Interpretation der CGM-Trendpfeile – wieviel und mit welchem Faktor bei welchem Glukosewert und Trendpfeil korrigiert werden sollte – „doch soll ich ihnen wirklich auch noch solche Infos mit auf den Weg geben? Ich kann dann schon verstehen, dass manche sich zu jeder Mahlzeit lieber pauschal fünf Einheiten spritzen. Das sind gefühlt nicht zu viel und nicht zu wenig,“ meinte Dr. Schlüter und brachte damit viele im Publikum zum Schmunzeln.
Diabetestechnologie muss so einfach sein wie ein Föhn
Weil Menschen also nur eingeschränkt willens oder in der Lage sind, viele Daten zu verarbeiten, ist Automatisierung aus ihrer Sicht unbedingt erstrebenswert. Denn: „Je mehr Daten und je höher der Grad der Automatisierung, desto besser sind HbA1c und Zeit im Zielbereich.“ Voraussetzung für den breiten Einsatz seien allerdings zum einen genaue und zuverlässige CGM-Systeme, ebensolche Insulinpumpen, adäquate Fortbildung und Schulung sowie Algorithmen, die einfach und selbsterklärend in der Anwendung sind. „Das muss so einfach sein wie bei einem Föhn. Bei der Taste ‚warm‘ muss warme Luft rauskommen, bei der Taste ‚kalt‘ dann kalte Luft“, erklärte die Diabetologin.
Wie sehr ein AID-System die Diabetestherapie im Alltag erleichtern kann, erläuterte sie an einem Beispiel aus ihrer Praxis. Ein 39-jähriger Mann, der aufgrund kognitiver Einschränkungen nicht gut mit Zahlen umgehen kann und einem initialen HbA1c von über 10 % aufwies, bekam ein AID-System und eine Tabelle mit seinen am häufigsten konsumierten Lebensmitteln. „Da steht drauf ein Brötchen gleich 30 g, zwei Brötchen gleich 60 g, drei Brötchen gleich 90 g, damit er weiß, welche Kohlenhydratmengen er in das System eingeben muss.“ Mit diesem Vorgehen sei sein HbA1c auf 7 % gesunken, berichtete Dr. Schlüter. In ihrer Praxis habe sich die stufenweise AID-Einführung in vier Phasen bewährt (siehe Kasten). In Phase 1 gelte es, Grundeinstellungen vorzunehmen, welche in den drei folgenden Phasen nachgebessert und verfeinert werden können. Die Diabetologin fasste zusammen: „Mit Automatisierung wird Diabetestechnologie inklusiver und praxistauglicher.“
AID-Start in vier Phasen
Phase 1: Grundeinstellungen vornehmen
- Kennenlernen des Systems
- eigenes Wissen checken
- AID-System starten
Phase 2: Grundeinstellungen nachbessern
- Gesamttagesdosis Insulin
- Datenmanagement
- Beobachten des AID-Systems
Phase 3: Grundeinstellungen nachbessern
- Geduld
- Gelassenheit
- AID-System rechnen lassen
Phase 4: Grundeinstellungen nachbessern
- Ernährung
- Bewegung
- AID-System arbeiten lassen
Pforte der Technologie öffnen oder zu lassen?
Trotz der unbestrittenen Vorteile sieht die Diabetesberaterin Claudia Kuhnert vom MVZ Stoffwechselmedizin Leipzig AID-Systeme nicht als universelle Lösung für alle an. Praxisteams wünschten sich von AID-Systemen bessere Therapieadhärenz und Motivation, mehr Zeit im Zielbereich, die Vermeidung von Akutkomplikationen, die Verzögerung von Folgekomplikationen und mehr Lebensqualität für die Patient*innen. „Doch was diese selbst wollen, wissen wir eigentlich nicht“, meinte sie und warnte: „Wir neigen dazu, uns für Technologien zu begeistern, bevor wir wissen, ob der Patient überhaupt bereit ist, seine Therapie zu ändern.“
Kuhnert forderte, man müsse ausgiebig darüber nachdenken, ob man die „Pforte der Technologie“ wirklich öffnen will. „Dabei ist es egal, ob jemand 20, 30 oder 70 Jahre alt ist – es muss genug technisches Verständnis da sein.“ Der Erfolg hänge auch davon ab, wie gut die Menschen geschult sind und ob das Diabetesteam über ausreichend viel Erfahrung mit AID-Systemen verfügt. „Noch vor drei Jahren gab es nur zwei bis drei AID-Systeme, inzwischen sind es deutlich mehr. Die Frage ist, ob wir diese Vielfalt adäquat bedienen und vermitteln können.“
Unterschiedliche Bedürfnisse – und Anwendungsprobleme
Ein Fallbeispiel verdeutlichte ihre Argumentation: Eine 28-jährige Frau entschloss sich trotz ihres exzellenten HbA1c von 6,8 % zu einem Wechsel von der Pumpen- zur AID-Therapie. „Als das System lief, waren die Glukosekurven glatt, doch die Patientin hatte gar keine Boli dokumentiert“, berichtete Kuhnert, „sie mochte gar keine Kohlenhydrate mehr essen, weil sie gefühlt nur noch mit dem Aufräumen des Zuckers beschäftigt war.“ Entsprechend unzufrieden war sie mit ihrem AID-System und kehrte schließlich zu einer konventionellen Insulinpumpentherapie zurück. „Wir müsen als Team akzeptieren und tolerieren, dass Patient*innen unterschiedliche Bedürfnisse haben,“ betonte Kuhnert.
Auch die korrekte Anwendung bezeichnete sie als ein großes Problem – und war mit dieser Einschätzung nicht allein. Auch viele der Teilnehmenden im Saal schätzten den Anteil derer, die ihr AID-System sachgerecht anwenden, nicht allzu hoch ein: Bei der entsprechenden TED-Frage wählten 49 % die Antwortoption 25 bis 50 %. Nur 26 % gehen davon aus, dass 50 bis 75 % ihrer Patient*innen ihr AID-System korrekt einsetzen. Vor der Entscheidung für ein AID-System gelte es daher zu klären, ob der Mensch mit Diabetes tatsächlich Kohlenhydrate berechnen kann und seine Korrekturfaktoren kennt. „Außerdem muss man lernen, nicht zu häufig einzugreifen, die Finger stillzuhalten und Vertrauen in die Technologie zu gewinnen“, erklärte Kuhnert. Sonst lerne der Algorithmus falsche Muster – ebenso wie wenn man sogenannte „Fake Carbs“ eingibt, um das System zu überlisten.
Die Diskussion zeigte klar: AID-Systeme bieten enormes Potenzial, insbesondere für Menschen mit Diabetes, die sich bei der manuellen Insulindosierung schwertun. Gleichzeitig erfordern sie eine hohe Bereitschaft zur Schulung und Anpassung. Ob die AID die richtige Wahl ist, hängt letztlich von den individuellen Bedürfnissen und Kompetenzen ab. Wie Claudia Kuhnert betonte: „Menschen, die etwas nicht wollen, haben immer gute Gründe dafür.“
Quelle: Diabetes Herbsttagung 2024