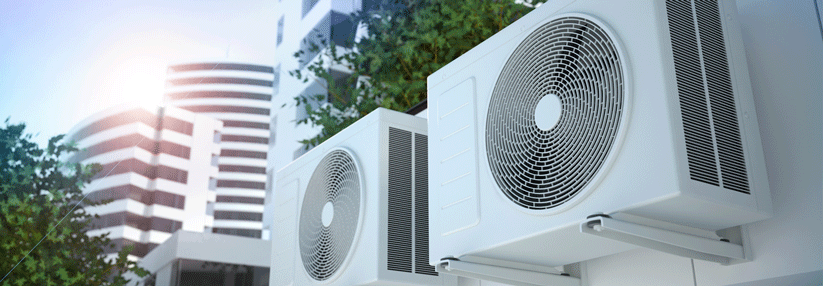Berater können Beschwerden von Patienten oft nicht aufklären
 Über 38 000 Rechtsberatungen betrafen Leistungsansprüche gegenüber den Kostenträgern.
© iStock/andrei_r
Über 38 000 Rechtsberatungen betrafen Leistungsansprüche gegenüber den Kostenträgern.
© iStock/andrei_r
Hat ein Patient die Kosten für eine Kopie seiner Patientenakte zu tragen? Und muss er Schadensersatz für einen unabgesagt nicht wahrgenommenen Arzttermin leisten? Diese Streitfragen sind scheinbar nicht aus der Welt zu schaffen.
Finanziert durch Mittel der GKV und PKV berät die Unabhängige Patientenberatung (UPD) Krankenversicherte neutral und kostenfrei in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen. Zusammen mit der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patienten legte die gemeinnützige Einrichtung jetzt ihren Bericht für 2019 vor. In ihm findet sich eine Auswertung der 130 000 durchgeführten Beratungen.
Über 38 000 Rechtsberatungen betrafen Leistungsansprüche gegenüber den Kostenträgern. Aber es gab auch Erkundigungen zu Konflikten mit Ärzten. So haben die UPD-Berater z.B. im vergangenen Jahr 2537 Anfragen zur „Einsichtnahme in die Patientenakte“ beantwortet. Eine wiederkehrende Frage lautete hier: Muss man dem Arzt Kopien der Patientenakte bezahlen?
„Leider ist diese Frage nach wie vor ungeklärt“, antwortet die UPD. Denn es bestehen zwei widersprüchliche Regelungen: Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) müssen die Patienten die Kopierkosten tragen. Gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung vom Mai 2018 hat dagegen der Arzt dem Patienten die erste Kopie kostenfrei zu überlassen. Erst wenn der Patient mehrere Exemplare anfordert, muss er die Kosten ab dem zweiten Exemplar übernehmen. Die UPD wünscht sich vom Gesetzgeber eine Klarstellung, welche Regelung Vorrang hat.
Nicht wirklich befriedigend fallen auch die Antworten zur Folge ungenutzter Arzttermine aus. Die UPD schildert das Beispiel einer Patientin, die einen Nachmittagstermin beim Hautarzt morgens absagte und dafür eine Rechnung über 60 Euro bekam. „Mein Arzt hat mir nie gesagt, dass ich etwas zahlen muss, wenn ich einen Termin nicht rechtzeitig absage“, klagte sie. Honorarforderungen im mittleren zweistelligen Bereich sind laut UPD üblich. Im Einzelfall könne es aber auch um mehrere Tausend Euro gehen, z.B. bei einer OP.
Leider könnten die Berater meist keine klaren Aussagen treffen. Denn für das Ausfallhonorar gebe es weder eine eindeutige Rechtsgrundlage noch eine einheitliche Rechtsprechung. Somit wissen die Versicherten oft auch nach der Beratung nicht, ob in ihrem Fall die Forderung berechtigt war. Da die Kosten eines drohenden Mahn- oder Gerichtsverfahrens das Ausfallhonorar um einiges übersteigen, „geben die Ratsuchenden an dieser Stelle oft klein bei“.
Die UPD nennt drei Wege, um ein Ausfallhonorar geltend zu machen:
- Behandlungsvertrag und Annahmeverzug (§ 615 S. 1 i.V.m. §§ 630a, 630b BGB): Einige Gerichte meinen, Behandler in Bestellpraxen können u.U. für Leerlauf ein Ausfallhonorar geltend machen.
- Behandlungsvertrag und Schadensersatz (§§ 280 Abs. 2 und 3, 282, 241 Abs. 2 BGB). Andere Gerichte entschieden: Patienten, die schuldhaft Termine nicht rechtzeitig absagen, verletzen ihre Nebenpflichten aus dem Behandlungsvertrag. Kann der Arzt beweisen, dass ihm durch eine verspätete Absage ein Verdienstausfall entstanden ist, kann er Schadensersatz beanspruchen.
- Schriftliche Vereinbarung (§ 630c Abs. 3 BGB): Wird eine Vereinbarung geschlossen, kann der Arzt den Ersatzanspruch am besten durchsetzen. Dabei sind dem Patienten 24 bis 48 Stunden für eine Absage einzuräumen. Und es muss geregelt sein, dass dieser kein Ausfallhonorar zahlen muss, wenn er keine Schuld an der nicht rechtzeitigen Absage hat.
Das grundsätzliche Problem sieht die UPD darin, dass die gesetzliche Aufklärungspflicht zwar die Kosten der Behandlung umfasst, aber nicht die einer Nichtbehandlung. Zur Lösung verweist sie auf die Berufsordnung der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg. Danach müssen die Psychotherapeuten ihre Patienten über Honorarregelungen aufklären. Ein Ausfallhonorar ist schriftlich zu vereinbaren.
Quelle: Patientenmonitor 2019 der UPD