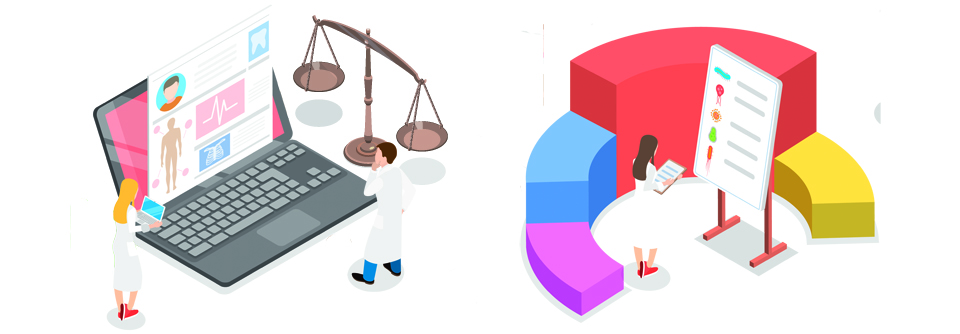Gesundheitspolitik Glaube, Liebe, Hoffnung
 Wird das zarte Pflänzchen DigiG irgendwann Früchte tragen? Noch sind viele Punkte des Entwurfs unausgegoren.
© Vadym – stock.adobe.com
Wird das zarte Pflänzchen DigiG irgendwann Früchte tragen? Noch sind viele Punkte des Entwurfs unausgegoren.
© Vadym – stock.adobe.com
Was sind die Kernthemen des DigiG? Es gibt erste Details zur Umstellung der elektronischen Patientenakte (ePA). Ab Februar 2024 müssen die Krankenkassen ihren Versicherten eine funktionierende ePA anbieten, Ende 2025 erwartet Minister Lauterbach bereits 80 Prozent der Versicherten im Besitz der ePA! Das soll durch die Umstellung auf Opt-out gelingen. Die ePA bleibt freiwillig, man muss aber aktiv widersprechen, wenn man sie als Versicherter nicht haben möchte. Glaube, Liebe, Hoffnung zum Ersten – denn die juristische Klärung des Opt-out-Verfahrens und wie der Widerspruch konkret geregelt werden soll, überlässt Lauterbach wider Erwarten nicht den spezialisierten Juristen, sondern der Selbstverwaltung. Welches Wort fällt einem bei „Selbstverwaltung“ ein? Blockade?
Mit der neuen ePA einher gehen einige Verpflichtungen für die Ärzte. Sie müssen die ePA befüllen, z.B. mit einem aktualisierten Medikationsplan, sofern der Patient dem Zugriff des behandelnden Arztes nicht widersprochen hat. Weiterhin startet der Kommunikationsdienst KIM in eine neue Phase: drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes müssen Ärzte „empfangsbereit“ sein für digitalen Arztbrief- und Befundversand. Ob es Sanktionen geben wird für widerwillige Ärzte, wie KBV und Hausärzteverband befürchten, ist ungeklärt. Das BMG hat sich dazu noch nicht konkret geäußert, außer zu einem Detail: Dem Arzt, der ab 1. Januar 2024 kein E-Rezept ausstellt, droht eine Honorarkürzung von einem Prozent.
Bei den DiGA wird es eine Reihe von Neuerungen geben. Grundsätzlich soll die Preisgestaltung – wohl auf Druck der Kassen – in Zukunft erfolgsabhängig gestaltet werden. Das wäre das erste Mal, dass wir in Deutschland ein funktionierendes Pay-for-Performance erleben! Glaube, Liebe, Hoffnung zum Zweiten: Welcher DiGA-Hersteller wird wissenschaftlich einwandfrei nachweisen können, dass der Behandlungserfolg auf seine DiGA zurückzuführen ist? Bisher waren DiGA als Medizinprodukte der Risikoklasse I und IIa zugelassen. Nun soll das Spektrum auf die höhere Risikoklasse IIb erweitert werden. Generell sollen DiGA stärker in die ärztliche Behandlung integriert werden.
Das BMG hat also eingesehen, dass der bisher ausgebliebene Erfolg der DiGA genau an diesem Punkt gescheitert ist. Der ursprüngliche Ansatz einer autonom beim Patienten angesiedelten DiGA hat dazu geführt, dass Ärzte sie so gut wie nicht verschrieben haben. Eine ganze Reihe von weiteren Ankündigungen im Entwurf, wie die anwendungsbegleitende Erfolgsmessung, eine einfachere Authentifizierung sowie die geplante 14-Tage-Probefrist, bleiben unausgegoren. Endgültige Klarheit soll eine Neufassung der DiGA-Rechtsverordnung bringen. Ebenso sind im Zusammenhang mit der neuen Zulassung von Risikoklasse IIb Fragen zur Patientensicherheit offen, die das die BMG und BfArM rechtzeitig beantworten müssen.
Interoperabilität – tatsächlich jetzt?
Einen weiteren Schwerpunkt setzt der Referentenentwurf bei der Interoperabilität. Die meisten Experten sehen im Mangel von Interoperabilität neben dem überzogenen Datenschutz den Hauptgrund dafür, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen hierzulande nicht vorankommt. Gerade die Diabetologie kann ein Lied davon singen, ist die nicht vorhandene Konnektivität der Datenmanagementsysteme plus ihre Peripherie untereinander und jeweils mit den PVS- und KIS-Systemen doch ein tägliches Ärgernis für die Diabetesteams.
Auf vielen Seiten widmet sich nun der Gesetzestext der Interoperabilität, was vor allem daran liegt, dass die bisherigen Bemühungen gescheitert sind; das gibt der Entwurf unumwunden zu. In allen bisherigen digitalen Gesetzen von Spahn bis Lauterbach war von verpflichtender Interoperabilität die Rede. Geschert hat sich darum keiner. Nun heißt es: Interoperable Informationssysteme stellen das technologische Fundament einer qualitativ hochwertigen gesundheitlichen Versorgung dar. Allerdings ist die Leistungserbringung in Deutschland fragmentiert und die Systeme sind heterogen – sie passen nicht zueinander, und gerade das ist für viele Software- und Technikfirmen bekanntermaßen das Geschäftsmodell! Deshalb entstehen dann Einbußen beim Austausch relevanter Behandlungsdaten.
Jetzt sollen die Standards verbindlich werden. Eine neu zu gründende Koordinierungsstelle für Interoperabilität akkreditiert zukünftig alle informationstechnischen Systeme, auch die bisher bestehenden, die in den Markt eintreten wollen. Sogar ein Sanktionsmechanismus wird erstmals definiert mit hohen Geldbußen, eine Beschwerdestelle sowie ein Patientenanspruch auf Interoperabilität.
Die offene Hardware-Frage
Eine entscheidende Frage bleibt aber offen: Was versteht der Gesetzgeber unter „informationstechnische Systemen“? Ist damit nur Software gemeint oder auch Hardware? Was ist mit Blutzuckermessgeräten, Smart-Pens, Insulinpumpen und CGM-Systemen? Das ist Hardware, die zurzeit meist nur mit der jeweils herstellereigenen Software kompatibel ist. Für eine Interoperabilität fehlt hier die offene Schnittstelle zum Download der Patientendaten in herstellerneutrale und interoperable Datenmanagement-Softwarelösungen.
Dies führt im heutigen Praxisalltag zu aufwendigen Downloads von Patientendaten über diverse Kabel oder Bluetooth und der anschließenden Datenanalyse in einer Vielzahl von unterschiedlichen herstellerindividuellen Softwarelösungen. Interoperabilität in der Diabetologie wird nur dann funktionieren, wenn Soft- und Hardware gleichermaßen unter den Begriff „informationstechnische Systeme“ fallen. Ohne diese ganzheitliche Betrachtung wäre dieser Teil des Digitalgesetzes das Papier nicht wert, auf dem es steht.
dDMP als große Chance
Videosprechstunden und Telekonsile sollen weiter flexibilisiert werden. Der 30-Prozent-Deckel bei der Honorierung wird ersatzlos gestrichen. Dies ist einerseits gut für dieses zarte digitale Pflänzchen, andererseits muss dafür gesorgt werden, dass die Begrifflichkeiten nicht durcheinandergeraten. Eine Videosprechstunde hat nichts mit der Videoschulung zu tun, die innerhalb der Diabetologie eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Eine Flexibilisierung darf nicht zu Qualitätseinschnitten führen. Der Hausärzteverband befürchtet schon eine Callcenter-Medizin, und natürlich müssen Videoschulungen genau wie analoge Patientenschulungen von qualifizierten Schulungskräften aus den behandelnden Teams kommen. Bei den Patienten wird sich langfristig durchsetzen, was ihnen mehr nutzt. Neue, digitale Techniken gehören bei den meisten Patienten heute schon dazu. Deshalb ist die neue Flexibilität zu begrüßen.
Äußerst interessant ist die etwas präzisere Darstellung der digitalen Weiterentwicklung von strukturierten Behandlungsprogrammen für Diabetes Typ 1 und Typ 2. In der Digitalstrategie waren sie angekündigt. Über diesen Komplex werden wir in einem gesonderten Artikel berichten, denn es gibt dazu eine neue Arbeitsgruppe von Gematik und DDG, die gerade erst ihre Arbeit aufnimmt. Hier wird es darauf ankommen, dass die Gematik-Mitarbeiter erst einmal verstehen, was ein DMP überhaupt ist und welche zentrale Rolle es – ob wie bisher analog oder demnächst digital – in der diabetologischen Schwerpunktpraxis auch finanziell spielt. Letztendlich wird es darum gehen, wie die Patientendaten aus der ePA ohne Mehrfacheingaben in das DMP und damit auch in die Abrechnung gelangen. Auch hierfür ist Interoperabilität notwendig und meiner Meinung nach eine Plattform, die übersichtlich und umfassend Anamnese, Diagnostik und Therapie inkl. der Patient Journey für den Behandler aufbereitet. So etwas ist ja auch schon im Entstehen.
Ein dDMP darf nicht nur ein digitalisiertes (analoges) DMP sein, sondern muss den bisherigen Arbeitsaufwand im Sinne einer verbesserten Prozessqualität in der Arztpraxis verringern. Viele Diabetologen stellen eine MfA-Vollzeitstelle allein für die Datenerfassung für das DMP ab! Neben der Prozessqualität darf man auch eine Qualitätssteigerung erwarten, die durch Benchmark-Daten und (langfristig gesehen) Clinical-Decision-Support, basierend auf den DMP-Daten der Praxis, angestrebt wird. dDMP ist im Entwurf des DigiG noch sehr oberflächlich beschrieben. Der Erfolg wird von der guten Zusammenarbeit zwischen Gematik und den Diabetologen abhängen.
Apropos Gematik: In dem Entwurf des DigiG kommt die Berliner bundeseigene GmbH nicht mehr vor. Lauterbach kündigte Anfang August ein eigenes Gematik-Gesetz an. Wann es kommt, sagte er nicht. Von der Leistung, den Kompetenzen und Entscheidungsbefugnissen hängt die Umsetzung des DigiG meines Erachtens aber entscheidend ab. Eine kleine Anfrage der CDU hat jetzt ergeben, dass die Unternehmensberatung Roland Berger sich um die zukünftige Aufstellung der dann „Nationale Digitalagentur“ heißenden Gematik kümmert – im Auftrag des Ministers und, nicht überraschend, für ein Honorar von mehreren Millionen Euro. Nicht zuletzt aus diesem Grund erwarte ich kein Inkrafttreten des Digitalgesetzes innerhalb der von Minister Lauterbach nach dem Motto „Glaube, Liebe, Hoffnung“ angekündigten Fristen.