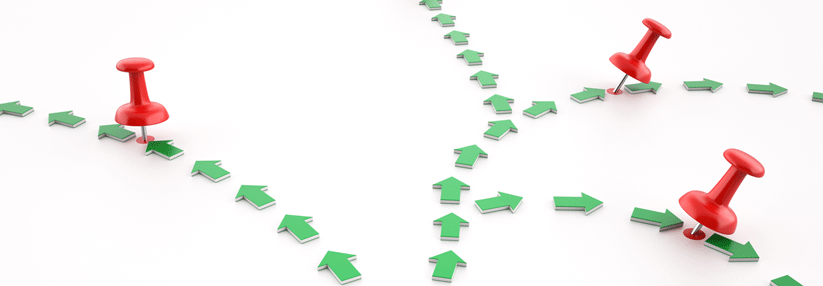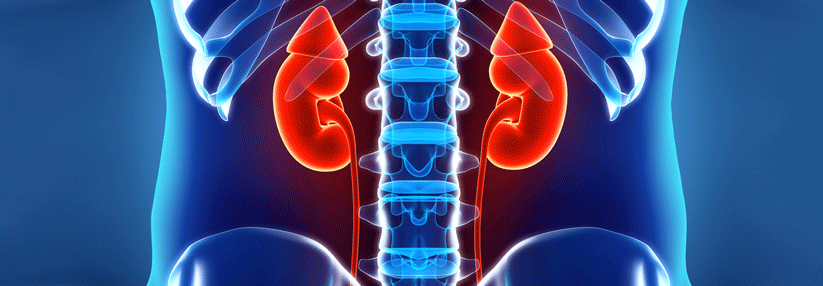
Bei Menschen mit Diabetes jährlich die Blasenfunktion checken
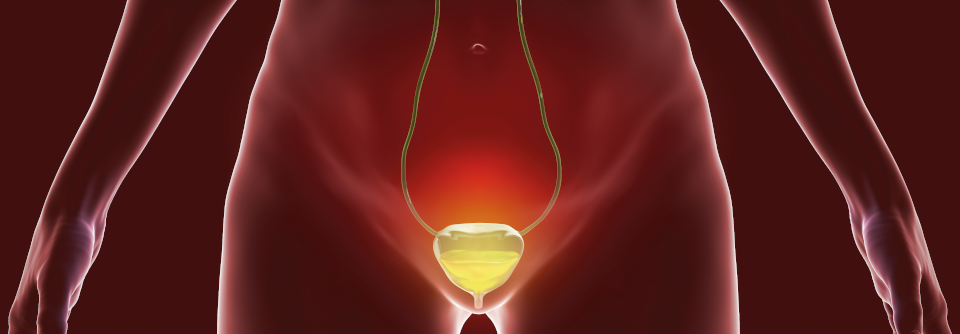 Blasenbeschwerden bei Diabetes beruhen meist auf einem komplexen Zusammenspiel von neuronaler, myogener und urothelialer Dysfunktion.
© Dr_Microbe - stock.adobe.com
Blasenbeschwerden bei Diabetes beruhen meist auf einem komplexen Zusammenspiel von neuronaler, myogener und urothelialer Dysfunktion.
© Dr_Microbe - stock.adobe.com
Unter den Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus spielen Funktionsstörungen des unteren Harntrakts eine wachsende Rolle. Nicht zuletzt in den entsprechenden Leitlinien werden sie aber noch zu wenig beachtet, findet Dr. Michael Rutkowski von der urologischen Abteilung des Landesklinikums Korneuburg. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Symptome langsam entwickeln und lange Zeit nicht wahrgenommen werden.
Ein komplexes Zusammenspiel aus neuronaler, myogener und urothelialer Dysfunktion bedingt die Beschwerden. Zunächst kann es bei Patientinnen und Patienten mit nicht insulinpflichtigem Diabetes zu Symptomen einer Blasenüberaktivität kommen. Im weiteren Verlauf nimmt die Sensibilität der Blase sowie die Kontraktilität des Detrusors mitunter ab. Betroffene geben verlängerte Miktionsintervalle und einen schwächeren Harnstrahl an. Über ein Restharngefühl berichten sie aufgrund der nachlassenden Sensibilität nicht immer.
Blasentagebuch und Uroflowmetrie helfen weiter
Einmal im Jahr sollte man Menschen mit Diabetes urologisch untersuchen lassen, rät der Kollege. Zur Basisdiagnostik gehören neben Anamnese und körperlicher Untersuchung die Sonografie von oberem und unterem Harntrakt sowie die Urinuntersuchung. Außerdem sind eine Uroflowmetrie und mindestens zweimal ein 24-h-Blasentagebuch (s. Kasten) zu empfehlen. Auch nach Medikamenten sollte man fragen. Z. B. kann eine Pollakisurie auf der Wirkung von SGLT-2-Inhibitoren beruhen, erinnert der Kollege. Ergeben sich Anhalte für eine Funktionsstörung, schafft die invasive urodynamische Messung als diagnostischer Goldstandard Klarheit.
Therapeutisch geht es einerseits darum, die Lebensqualität zu erhöhen. Andererseits soll die Lebenserwartung verbessert werden, indem man Langzeitkomplikationen verhindert. Die Behandlungsmöglichkeiten sind jedoch nicht immer evidenzbasiert und vielfach nur für Menschen ohne Diabetes evaluiert, schreibt Dr. Rutkowski.
Ein Tagebuch für die Blase
Im 24-h-Blasentagebuch sollen Patientinnen und Patienten Folgendes dokumentieren:
- Trinkverhalten
- Miktionsintervalle und -volumina
- Nykturie und eventuelle nächtliche Polyurie
Wenn die Blasenüberaktivität dominiert, bieten sich Verhaltensmaßnahmen wie die „Miktion nach der Uhr“ an. Dabei sollen die Betroffenen in definierten Zeitabständen zur Toilette gehen, bevor ein kritisches Harnvolumen erreicht wird. Von den Medikamenten gelten Antimuskarinika als erste Säule. Unter dieser Medikation muss man die Restharnmenge sonografisch kontrollieren.
Botulinumtoxin A wirkt ähnlich gut wie Antimuskarinika, birgt aber die Gefahr eines Harnverhalts und ist zweite Wahl. Als weitere Option nennt der Autor Mirabegron. Für Patientinnen und Patienten unter Multimedikation und mit Komorbiditäten kommt die tibiale Nervenstimulation infrage. Sie kann nach Schulung ein- bis dreimal pro Woche von den Betroffenen selbst durchgeführt werden. Die Methode ist nebenwirkungsarm, aber offenbar weniger effektiv als Antimuskarinika.
Bei einer Entleerungsstörung können Alphablocker und 5-Alpha-Reduktasehemmer helfen. Deren Effektivität wurde bislang aber überwiegend für Männer mit vergrößerter Prostata belegt. Nehmen Restharn bzw. Harnverhalt trotzdem zu, muss die Blase i. d. R. mechanisch entleert werden. Primär empfiehlt sich der intermittierende Einmalkatheterismus, gefolgt von einer Versorgung mit Dauerkatheter. Bei Letzterer sollte ein suprapubischer Katheter einer Ableitung durch die Harnröhre vorgezogen werden.
Quelle: Rutkowski M. Urologie 2024; DOI: 10.1007/s00120-024-02506-0
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).