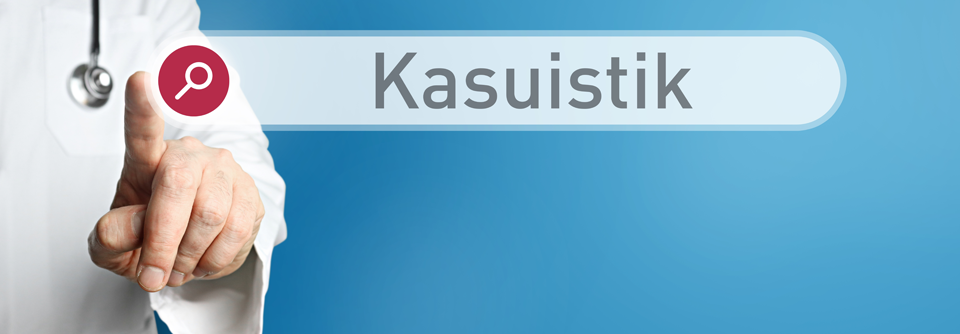
Patientin mit IgAN und aktuem Nierenversagen
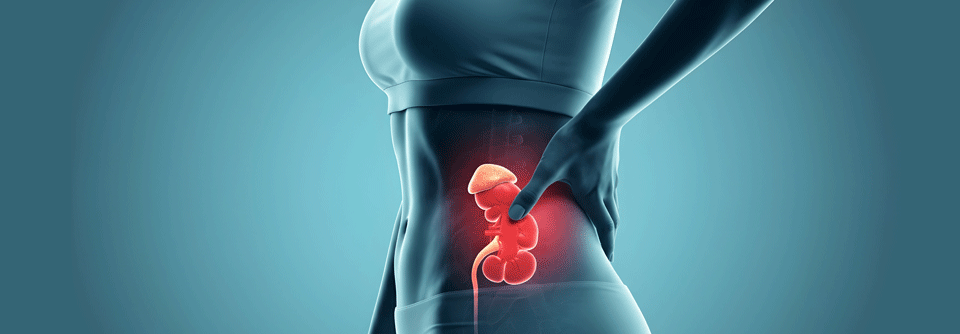 Die Patientin mit einer bekannten IgAN ist unter Therapie mit einem SGLT2-Inhibitor gut eingestellt bei bisher normaler Nierenfunktion.
© artistic - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Die Patientin mit einer bekannten IgAN ist unter Therapie mit einem SGLT2-Inhibitor gut eingestellt bei bisher normaler Nierenfunktion.
© artistic - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Der Fall
Eine 42jährige Patientin mit bekannter und bioptisch nachgewiesener IgAN berichtet über plötzlich auftretende
- Schlappheit und muskuläre Schwäche
- Belastungsdyspnoe
- rezidivierendes Erbrechen
- Gewichtsverlust
Vorbestehende Diagnosen:
- IgA [Immunglobulin A]-Nephropathie
- Persistierende Proteinurie
- Erythrozyturie
- Hypothyreose
Zwischenanamnese:
Die 42-jährige Patientin stellte sich zur Verlaufskontrolle vor. Sie berichtete, dass es ihr gut ginge bei persistenter Proteinurie und nierenbioptisch gesicherter IgA-Nephropathie. Keine Dyspnoe, keine peripheren Ödeme, keine urämischen Symptome und keine Angina-pectoris-Symptomatik. Der zuhause gemessene Blutdruck lag bei 100/60 mmHg. Stuhlgang und Miktion waren unauffällig.
Befunde zu diesem Zeitpunkt:
Es zeigte sich unter der Therapie mit einem SGLT-2-Inhibitor eine weiterhin normale Nierenfunktion mit einer eGFR von 108,6 ml/min pro KÖF und einem Kreatinin von 0,54 mg/dl. Begleitend konnte in der Urindiagnostik eine signifikante Proteinurie sowie Albuminurie ausgeschlossen werden. Dies war ebenfalls auf den SGLT-2-Inhibitor zurückzuführen. Die leichte Verminderung der Nierenfunktion im normwertigen Bereich war ebenfalls in diesem Rahmen zu interpretieren. Eine Hämaturie zeigte sich nicht. Laborchemisch konnte eine Anämie bei suffizienten Substraten in Form von Vitamin B12, Folsäure und Eisen ausgeschlossen werden. Es persistierte eine unklare Eosinophilie. Hier waren weitere Verlaufskontrollen geplant. Der Knochenstoffwechsel zeigte keine Pathologien bis auf einen leichten Vitamin-D-Mangel. Hier wurde der Patientin Vitamin D sonntags während der Wintermonate empfohlen. Die Lipide zeigten sich therapeutisch. Die Elektrolyte wiesen keine Pathologien auf. In der BGA konnte eine metabolische Azidose ausgeschlossen werden. Insgesamt zeigte sich eine stabile chronisch- funktionelle Nierenerkrankung bei bioptisch gesicherter IgA-Nephropathie, derzeit in Vollremission. Wiedervorstellungen sollten intervallmäßig erfolgen.
Medikation:
L-THYROXIN 88-1A Pharma Tabletten 1 - 0 - 0 - 0
CANDESARTAN AL 8 mg Tabletten ½ - 0 - 0 - 0
FORXIGA 10 mg Filmtabletten 1 - 0 - 0 - 0
Im weiteren Verlauf:
Deutliche akute Allgemeinzustandsverschlechterung. Daraufhin erfolgte die ambulante Vorstellung der Patientin in der zentralen Notaufnahme nach Zuweisung durch den Nephrologen bei unklarer Anämie und akutem Nierenversagen bei Hyperkalzämie und Hypoparathyreoidismus.
Aktuelle Anamnese:
- Insgesamt besteht eine deutliche Verschlechterung der Allgemeinzustands mit allgemeinem Schlappheitsgefühl
- Belastungsdyspnoe
- muskuläre Schwäche
- Beinn der Symptomatik nach der Covid-19-Infektion im letzten Monat
- Dabei begleitendes akutes Nierenversagen
- Nachfolgend Schwäche und Kurzatmigkeit
Aktuelle Befunde während erneutem
Krankenhausaufenthalt:
Gastroskopie bei unklarer Anämie:
Hier wurde eine Typ-C-Gastritis diagnostiziert.
Koloskopie:
Kein pathologischer Befund.
Pleurapunktion:
Es zeigten sich beidseitige Pleuraergüsse mit Nachweis eines Transsudates, histologisch ausstehend.
Weitere Bunderhebung:
- Insgesamt persistierende Übelkeit mit rezidivierendem Erbrechen einmal am Tag
- Stuhlgang unauffällig und bräunlich gefärbt. Keine Beschwerden bei der Miktion, keine Dysurie, kein schäumender Urin oder Urinverfärbung. Trinkmenge ca. 1 l/Tag, Ausscheidung ebenso
- Innerhalb von 3 Monaten Gewichtsverlust von 10 kg, aktuelles Gewicht 48 kg bei reduzierter Nahrungsaufnahme aufgrund von Übelkeit
- Kein Fieber oder Nachtschweiß
- Keine Ruhedyspnoe, flach schlafen möglich
- keine Angina-Pektoris-Beschwerden
- Blutabnahme: Schilddrüse zeigt sich dort erneut überdosiert. Es wurde der Verdacht einer Dysfunktion der Nebenschilddrüse bei Hyperkalzämie gestellt, daher wurde dringend eine stationäre Aufnahme vom Nephrologen empfohlen
- Keine Nahrungsergänzungsmittel, Allergien sind nicht bekannt. Suchtanamnese: Nichtraucher, gelegentlich Alkohol
- Familienanamnese: Großmutter mit Nephrektomie
Klinischer Untersuchungsbefund
Bei der klinischen Untersuchung zeigt sich die 42-jährige Patientin in reduziertem Allgemeinzustand, Ernährungszustand schlank, GCS 15 Punkte. Vitalwerte: Herzfrequenz 107/min, Atemfrequenz 15, SpO₂ 100 %, Temperatur 36,9°, Blutdruck 84/45 mmHg. Die Patientin ist wach, kooperativ und orientiert zu Zeit, Ort, Person und Situation. Es liegen weder ein Ikterus noch eine Zyanose vor. Die Schleimhäute sind feucht, keine peripheren Ödeme. Lunge: Sonorer Klopfschall, vesikuläres Atemgeräusch seitengleich, keine Herzgeräusche, Halsvenen nicht gestaut. Abdomen: weich, kein Druckschmerz, keine Abwehrspannung, Darmgeräusche in allen Quadranten auskultierbar, keine Hepatomegalie palpabel, Milz nicht palpabel, kein Klopfschmerz über dem Nierenlager. Keine pathologischen Untersuchungsbefunde für Kopf, Hals, Extremitäten, keine Thrombosezeichen. Neurologische Untersuchung orientierend unauffällig.
Epikrise
Die stationäre Aufnahme der Patientin erfolgte direkt auf die intermediate Care Station bei Hyperkalzämie mit Gesamtkalzium von 3,5 mmol/l. Parallel lag eine Hyperphosphatämie vor bei adäquat supprimiertem Parathormon und mildem Vitamin-D-Mangel. Es wurde zunächst eine Volumensubstitution in geringer Dosis mit begleitender Gabe von Schleifendiuretika begonnen. Zur Abklärung der Genese wurde ein CT-Thorax/Abdomen durchgeführt. Bei unklarer Uterus-Verdichtung erfolgt die gynäkologische Untersuchung. Sowohl die klinische Untersuchung und auch die Bestimmung der Tumormarker CA-125 und des CCT ergab keinen Anhalt auf ein gynäkologisches Malignom bei am ehesten Adenomyosis uteri. Auffällig war lediglich eine geringe Menge Aszites in der gynäkologischen Untersuchung, sodass ein MRT des Beckens empfohlen wurde zur weiteren Abklärung. Extern erfolgte bereits eine endoskopische Abklärung mittels Gastroskopie und Koloskopie ohne Malignomnachweis. Bei Adynamie und Hypoglykämie erfolgte die Bestimmung eines basalen Kortisols. Dieses zeigte sich deutlich erniedrigt.
Laborwerte:
| Kenngröße | Maßeinheit | Laborparameter | Referenzbereich |
|---|---|---|---|
| eGFR nach CKD-Epi | ml/min | Aktuell 40,9 Vorher* 108,6 | |
| Kreatinin | mg/dl | Aktuell 0,87 Vorher* 0,54 | 0,67-1,18 |
| Cystatin C | mg/l | Aktuell 1,4 Vorher* 0,75 | 0,85-1.35 |
| PTH | mmol/l | 5,58 | 15-65 |
| Calcium | mmol/l | 2,86 | 2.15-2.58 |
| Triglyceride | mg/dl | 260 | <150 |
| Harnsäure | mg/dl | 5,45 | 2,3-6,1 |
| GPT | mg/l | 49 | 10-50 |
| TSH | mIU/l | 0,92 | 0.40-4.00 |
| FT 3 | pmol | 7,72 | 3,1-6,8 |
| Ges. Eiweiß im Urin | mg/l | 262 | <150 |
| Albumin im Serum | g/l | 310 | 35-53 |
| Protein im Serum | g/l | 54 | 65-80 |
| Phosphat | (photom.) | 1,77 | 0.84-1.45 |
| Calcium i.S. | mmol/l | 3,49 | 2,15-2,50 |
| Hämoglobin | g/dl | 8,9 | 12-15,6 |
| Retikulozyten | /nl | 124 | 25-105 |
| Knochen AP | Ug/l | 3,8 | 5-27 |
| Cortisol | Ug/dl | 0,54 | |
| DHEA-Sulfat | Ug/dl | <3 | 60.9-337 |
| STH (HGH) | ng/ml | 0,52 | Bis 10 |
| IGF 1 | Ng/ml | 78,8 | 86.5-222 |
| * Vorher = Vorwerte vor 3 Monaten | |||
| Immunologische Diagnostik | Maßeinheit | Laborparameter | Referenzbereich |
|---|---|---|---|
| ANA | 1:80 | < 1:80 | |
| Doppelstrang-DNS-Ak | < 5 | < 5 | |
| ANCAs | < 1:20 | < 1:20 | |
| Bence-Jones-Protein im Urin | Nicht nachweisbar | ||
| κ-Leichtketten im Serum | g/l | 0,0044 | 0,003-0,01 |
| λ-Leichtketten im Urin | g/l | 0,005 | 0,006-0,02 |
| Pospholipase-2-Rezeptorantikörper (PLA-2-RezeptorAntikörper) | U/m | 12 | <14 |
| HIV 1/2 | Neg. | Neg. | |
| Hepatits B | Neg. | Neg. | |
| Komplementfaktoren C3 | mg/dl | 90 | 88-228 |
| Komplementfaktoren C4 | mg/dl | 20 | 16-47 |
| HbA1c | % | 6,7% | <6% |
| Urinstatus | |||
|---|---|---|---|
| Ery qual. | 0 | Negativ | |
| Leuko qual. | neg | Negativ | |
| Protein qual. | 3+ | Negativ | |
| Glukose qual. | pos | Negativ/ Norm | |
| Keton qual. | neg | Negativ | |
| Bili qual. | neg | Negativ | |
| Urobilinogen qual. | μmol/l | 3,2 | <16 |
| ph-Wert | 6,6 | ||
| Nitrit qual. | neg | Negativ | |
| Dichte | 1,010 | ||
Bezüglich der hyporegeneratorischen Anämie konnte ein Eisen-, Vitamin B12- und Folsäuremangel ausgeschlossen werden. Es besteht kein Hinweis für eine Hämolyse. Eine Blutungsquelle war endoskopisch extern nicht gesehen, es bestehen aktuell keine Blutungsstigmata. 3 Monate zuvor bestand noch ein normaler Hb-Wert. Das Differentialblutbild zeigt keinen Hinweis für eine maligne hämatologische Systemerkrankung. Die Proteinelektrophorese war ebenfalls unauffällig.
Was könnte die Ursache der Symptomatik im vorliegenden Fall sein?
Diagnose
Morbus Addison
Therapeutisches Vorgehen:
Unter dem Verdacht einer Addisonkrise wurde eine intravenöse Substitution mit Hydrocortison begonnen. Hierunter war die Hyperkalzämie ohne weitere kalziumssenkende Maßnahmen rasch normalisiert und eine begleitende milde Hyponatriämie normwertig im Verlauf. Die Patientin gab rasch eine Besserung der Beschwerden (Adynamie, Knochenschmerzen) an. Sie konnte schließlich auf die Normalstation verlegt werden. Die Bestimmung der Nebennierenantikörper war positiv, sodass die Verdachtsdiagnose eines Morbus Addison bestätigt werden konnte. Unter Hydrocortison-Substitution sind im Verlauf Hb und Retikulozyten angestiegen. Eine ambulante Hb-Kontrolle und gegebenenfalls eine hämatologische Vorstellung ambulant ist bei anhaltender Anämie zur weiteren Abklärung zu empfehlen.
Medikation:
L-Thyroxin 75 µg
Hydrocortison 10 mg 2-1-0-0
Vitamin D 2000 IE 1-0-0
Forxiga 10 mg pausiert
Die Hydrocortisongabe konnte im Verlauf oralisiert und auf eine Erhaltungsdosis reduziert werden.
Hinweise zur lebenslangen Hydrocortisongabe bei Morbus Addison
Eine lebenslange Einnahme der Medikation ist zwingend erforderlich, dabei ist eine Dosisanpassung bei Stresssituation (psychische und physische Belastungen, Fieber, Infekte, Operation etc.) zu beachten. Patienten sind zu schulen bezüglich dieser gegebenenfalls erforderlichen Dosisanpassungen und dem richtigen Verhalten in Notfallsituationen. Eine ambulante endokrinologische Anbindung sollte in jedem Fall erfolgen.
Hyperkalzämie:
Bezüglich der Hyperkalzämie wurde initial bei deutlich erniedrigter knochenspezifischer alkalischer Phosphatase sowie Knochenschmerzen auch das Vorliegen einer Hypophosphatasie diskutiert. Die Hyperkalzämie war unter der Hydrocortison-Substitution im Verlauf jedoch rasch normalisiert. Es kam sogar ohne kalziumsenkende Therapie zu einer Hypokalzämie und Hypophosphatämie. Die Kalziumsausscheidung Urin war niedrig. Es wurde eine Vitamin-D-Substitution bei Vitamin-D-Mangel begonnen und Kalzium oral substituiert. Darunter war das Kalzium im Verlauf wieder normalisiert. Hyperkalzämien sind auch im Zusammenhang mit Addisonkrisen beschrieben. Unter Berücksichtigung aller Befunde und der raschen Besserung unter Hydrocortison-Substitution ist am ehesten von einer Hyperkalzämie im Rahmen des Morbus Addison auszugehen. Die Nierenretentionsparameter waren mit Ausgleich der Hyperkalzämie und Volumengabe im Verlauf normalisiert.
Diagnosen:
1.Addisonkrise bei Erstdiagnose Morbus Addison, positive Nebennierenantikörper
2.Hyperkalzämie am ehesten im Rahmen des Hypercortisolismus
- Adäquat supprimiertes Parathormon
- CT-Thorax/Abdomen ohne Hinweis für solide Neoplasien
- Unter Hydrocortison im Verlauf Hypokalziämie bei Vitamin-D-Mangel
3.Akutes Nierenversagen am ehesten prärenaler Genese bei Hyperkalzämie
4.Hyporegeneratorische Anämie:
- Gastroskopie und Koloskopie ohne Blutungsquelle
- DD Anämie bei Gastritis: Gastroskopie aktuell Typ-C-Gastritis
- Keine Helicobacter-pylori-Infektion
- Ausschluss Eisen-, Folsäure- und Vitamin-B12-Mangel,
- Differentialblutbild und Proteinelektrophorese unauffällig.
- Unter Substitution von Hydrocortison Retikulozyten und Hb-Anstieg
6.Eosinophile Ösophagitis, PPI-Therapie erfolgt
7. Restriktive Ventilationsstörung bei Z. n. Covid-19-Infektion, DD Post-Covid-Syndrom.
- Low-dose HR-CT: keine interstitielle Lungengerüstveränderung
- diagnostische Pleurapunktion: erfolgte mit Transsudat
8.Kein Anhalt für einen Herzinfarkt, kein Anhalt für eine Perimyokarditis
- Transthorakale Echokardiografie: Normale linksventrikuläre Funktion
9. Chronische Beckenschmerzen
- Skelettszintigrafie ohne Nachweis einer ossären Metastasierung
10. Substituierte Hypothyreose
11. IgA-Nephritis, Erstdiagnose 2010
Erklärung:
Es bestätigte sich die Verdachtsdiagnose eines Morbus Addison. Bezüglich der Hyperkalzämie wurde initial bei deutlich erniedrigter alkalischer knochenspezifischer Phosphatase sowie Knochenschmerzen auch das Vorliegen einer Hypophosphatasie diskutiert. Die Hyperkalzämie war unter der Hydrocortison-Substitution im Verlauf jedoch rasch normalisiert. Es kam sogar ohne kalziumssenkende Therapie zu einer Hypokalzämie und Hypophosphatämie. Die Kalziumsausscheidung im Urin war niedrig. Es wurde eine Vitamin-D-Substitution bei Vitamin-D-Mangel begonnen und Kalzium oral substituiert. Darunter war das Kalzium im Verlauf wieder normalisiert. Hyperkalzämien sind auch im Zusammenhang mit Addisonkrisen beschrieben. Unter Berücksichtigung aller Befunde und der raschen Besserung unter Hydrocortison-Substitution ist am ehesten von einer Hyperkalzämie im Rahmen des Morbus Addison auszugehen. Die Nierenretentionsparameter waren mit Ausgleich der Hyperkalzämie und Volumengabe im weiteren Verlauf normalisiert. Bezüglich der hyporegeneratorischen Anämie konnte ein Eisen-, Vitamin B12- und Folsäuremangel ausgeschlossen werden. Es besteht kein Hinweis für eine Hämolyse. Eine Blutungsquelle wurde endoskopisch extern nicht gesehen, es bestehten aktuell keine Blutungsstigmata. 3 Monate zuvor bestand noch ein normaler Hb-Wert. Das Differentialblutbild zeigt kein Hinweis für eine maligne hämatologische Systemerkrankung. Die Proteinelektrophorese ist ebenfalls unauffällig. Unter Hydrocortison-Substitution stiegen im Verlauf der Hb und die Retikulozyten an. Zu empfehlen ist eine ambulante Hb-Kontrolle sowie gegebenenfalls eine hämatologische Vorstellung ambulant zur weiteren Abklärung bei anhaltender Anämie.
Die primäre Nebenniereninsuffizienz (Morbus Addison)
Verursacht wird diese meist durch 21–Hydroxylase-Antikörper. Dieses Enzym ist wichtig für die Steroidsynthese. Der Nachweis diesen Antikörper ist fast schon beweisend für eine primäre Nebenniereninsuffizienz.In 80 % der Fälle ist eine autoimmun vermittelte Adrenalitis die Ursache. Es erkranken mehr Frauen als Männer in jüngerem bis mittlerem Lebensalter an dieser Erkrankung. Die irreversible Schädigung der Nebennierenrinde führt zu einer insuffizienten Hormonproduktion von Glukokortikoiden, Mineralokortikoiden und Androgenen. Hiervon unterschieden wird die sekundäre Form der Nebenniereninsuffizienz, welche durch eine Störung auf Hypophysenebene bedingt ist. Hier ursächlich ist meist ein Hypophysenadenom oder eine traumatische Schädigung. Aufgrund eines ACTH-Mangels wird die Cortisolsynthese nicht mehr angeregt. Die Nebennierenrinde atrophiert und die Cortisolskretion versiegt (3).
Therapie:
Lebenslange Einnahme von Hydrocortison. Die Hydrocortisongabe konnte im Verlauf oralisiert und auf eine Erhaltungsdosis reduziert werden. Eine lebenslange Einnahme der Medikation ist zwingend erforderlich sowie eine Dosisanpassung bei Stresssituation beispielsweise aufgrund psychischer oder physischer Faktoren oder durch Fieber, Infekte, Operation oder ähnliches. Die Patientin wurde geschult bezüglich der Notwendigkeit von Dosisanpassungen und hinsichtlich des richtigen Verhaltens in Notfallsituationen. Eine ambulante endokrinologische Anbindung erfolgte ebenfalls.
Pathophysiologie der Nebenniereninsuffizienz und der Hyperkalziämie
Eine Hyperkalzämie als Folge einer Nebenniereninsuffizienz ist selten. Die Ursache ist bis heute nicht sicher bewiesen. Die Prävalenz liegt zwischen 6,5 und 8,4 % der Patienten. Es werden verschiedene Mechanismen beschrieben, die zu dieser Hyperkalzämie führen könnten. Zum einen ist hier ein erhöhter Knochenumsatz wie eine erhöhte proximal tubuläre Kalzium-Reabsorption oder eine erhöhte Bindungskapazität des Kalziums an Serumproteine diskutiert worden. Die Nebenniereninsuffizienz kann ebenfalls zu einer erhöhten Aktivität der renalen 1-alpha-Hydroxylase führen, die das inaktive Vitamin D ins aktive Vitamin D verwandelt. Aktives Vitamin D sorgt für eine erhöhte intestinale sowie renale Absorption von Kalzium und erhöht somit das Serumkalzium-Level. Ein zusätzlicher Faktor wird die Hypovolämie sein (2).
Zusätzliches Risikoprofil:
Bei der Patientin liegt mit der Immunthyreopathie und Morbus Addison ein erhöhtes Risiko für die Entstehung eines Autoimmundiabetes vor. Aktuell zeigt sich jedoch kein Hinweis auf einen Typ-1-Diabetes.
Merke
Patientinnen und Patienten mit einer autoimmunen Thyreopathie und einem Morbus Addison, antikörper assozierter Nebenniereninsuffizienz oder auch einer Zöliakie haben ein erhöhtes Risiko, einen Diabetes mellitus Typ 1 zu entwickeln. Im Rahmen einer komplexen polygenetischen Störung mit einer spezifischen HLA-2-Klassifikation ist am häufigsten eine Addison-Erkrankung beschrieben. Zudem sind Hashimoto-Thyreoditis und Diabetes mellitus Typ 1 assoziiert (1).
Literatur
1. Francesco Vinci et al. Typ 1 Diabetes and Addison´s Disease: When the Diagnosis Is Suggested by the Continus Glucose Monitoring System, Children 2021, 8, 702
2. Magacha HM, Paravez M A, Vedantam V, et al., (July 24, 2023) Unexplained Hypercalcemia: A Clue to Adrenal Insufficiency. Cureus 15(7); e4205
3.MarcusQuinkler,https://www.aerzteblatt.de/archiv/159258/Nebennierenrinden-Insuffizienz
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).



