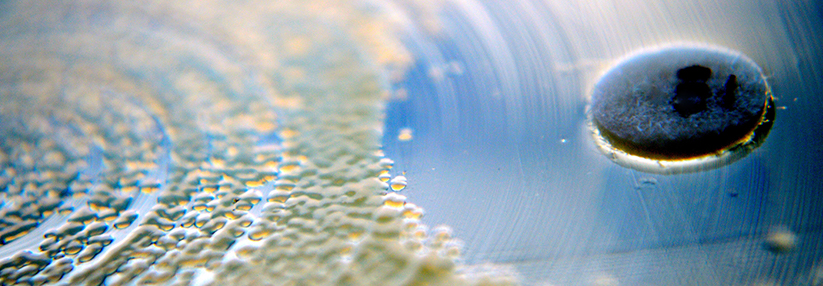Wie lassen sich unnötige Antibiotikatherapien vermeiden?
 Therapiebedürftig ist die asymptomatische Bakteriurie nur bei Schwangeren und vor urologischen Eingriffen, wie die Leitlinien feststellen.
© iStock/MJ_Prototype
Therapiebedürftig ist die asymptomatische Bakteriurie nur bei Schwangeren und vor urologischen Eingriffen, wie die Leitlinien feststellen.
© iStock/MJ_Prototype
Nach wie vor zu häufig mit Antibiotika behandelt wird die asymptomatische Bakteriurie. Therapiebedürftig ist dieser Befund aber nur bei Schwangeren und vor urologischen Eingriffen, wie die Leitlinien feststellen. Ansonsten bringt die Behandlung dem Patienten keinen Vorteil: Sie reduziert weder das Auftreten von Komplikationen wie Pyelonephritis und Urosepsis noch die damit verbundene Mortalität. Auch die Zahl der (symptomatischen) Harnwegsinfekte wird nicht verringert, betonen Dr. Anahita Fathi und Kollegen vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Adäquate Indikation in nur 60 % der Fälle gegeben
Gleichzeitig birgt der nicht-indizierte Antibiotikaeinsatz ein erhebliches Schadenspotenzial. Abgesehen von individuellen Folgen für den Patienten wie unerwünschte Arzneimitteleffekte oder das vermehrte Auftreten von Infektionen mit Clostridioides difficile, steht dabei natürlich die Entwicklung bakterieller Resistenzen im Fokus.
Allerdings kann die Differenzierung zwischen harmloser Bakteriurie und Harnwegsinfekt in der Praxis schwierig sein, insbesondere bei multimorbiden oder kognitiv eingeschränkten Patienten. Um einen Übergebrauch von Antibiotika zu vermeiden, empfehlen die Autoren, Urinkulturen nur bei klinischem HWI-Verdacht anzulegen. Ausnahmen: Schwangerschaft und geplante Operation z.B. an der Prostata.
Auch in anderen Indikationsbereichen wird die antiinfektive Therapie möglicherweise noch zu großzügig eingesetzt. So ermittelte eine US-Studie mit fast 30 000 zufällig ausgewählten Behandlungen, dass nur in 60 % der Fälle eine adäquate Indikation vorlag. Am häufigsten betroffen: Chinolone – trotz des relativ hohen Nebenwirkungsrisikos dieser Substanzgruppe.
Im Rahmen einer vergleichbaren deutschen Untersuchung verordneten Allgemeinärzte, Internisten und Urologen ebenfalls auffällig häufig Ciprofloxacin. Das Chinolon wurde vor allem bei Harn- und Atemwegsinfekten verschrieben, obwohl die Leitlinien andere Antibiotikagruppen bevorzugen. Außerdem fiel in der Studie eine deutliche saisonale Häufung im Winter auf, was auf eine vermehrte Fehlanwendung bei in der Regel meist viralen respiratorischen Infektionen hindeutet.
Bei vielen Erkrankungen sind Betalaktame wegen ihrer guten Wirksamkeit und Verträglichkeit Mittel der ersten Wahl. Oft verhindert jedoch eine angebliche Penicillinallergie den Einsatz.
Unverträglichkeit fälschlich als Allergie gedeutet
Sie ist inzwischen die am häufigsten in Krankenakten aufgeführte Allergie und betrifft im stationären Bereich schon bis zu 20 % der Patienten. Studien ergaben jedoch, dass in vielen Fällen eine andere Form der Unverträglichkeit fälschlich als Allergie gedeutet wird. Bei zahlreichen Patienten liegt die Reaktion auch so weit zurück, dass vermutlich keine allergische Disposition mehr besteht.
Zu viel Kultur
Quelle: Fathi A et al. Internist 2021; 62: 373-378; DOI: 10.1007/s00108-021-00967-5
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).