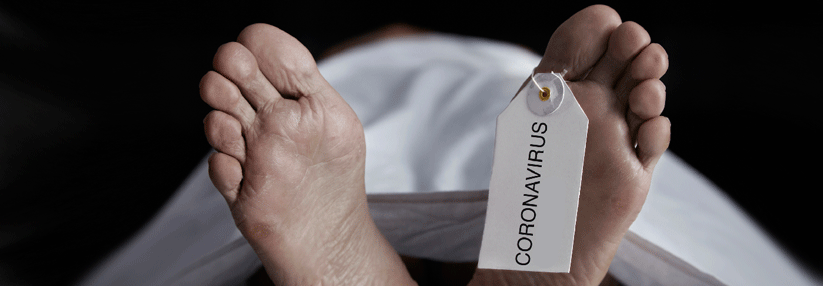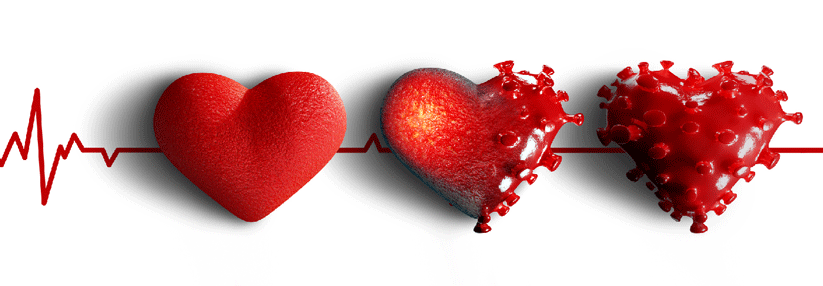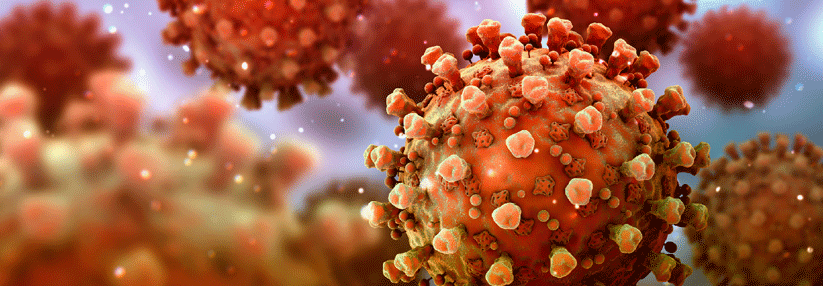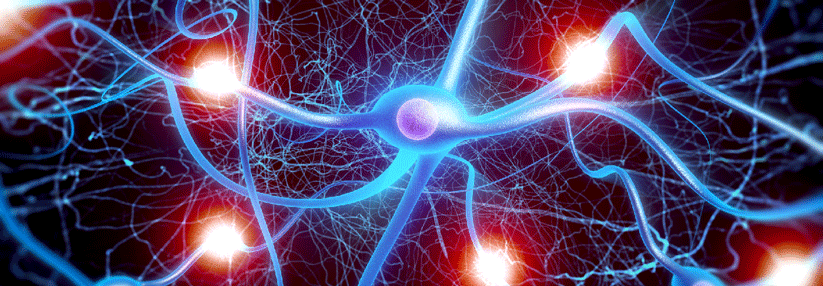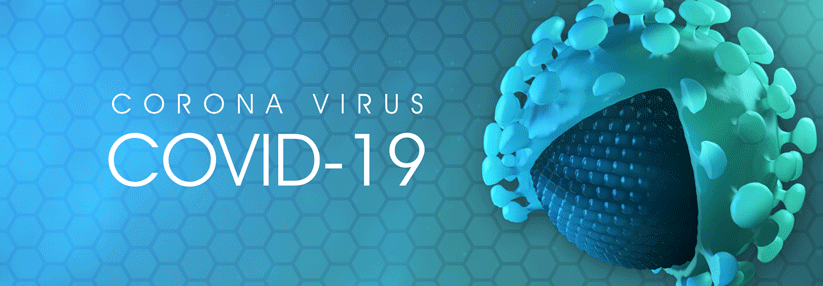
Corona-Patienten sterben nicht an, sondern trotz invasiver Beatmung
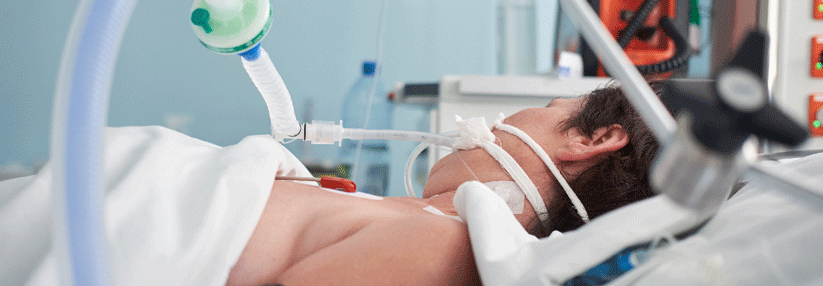 Rechtzeitig in die invasive Beatmung einzusteigen, kann Leben retten.
© Kiryl Lis – stock.adobe.com
Rechtzeitig in die invasive Beatmung einzusteigen, kann Leben retten.
© Kiryl Lis – stock.adobe.com
COVID-19 macht es den Ärzten schwer, weil sie für eine Viruspneumonie so ungewöhnlich verläuft und mit den gängigen Definitionskriterien für ein ADRS (Acute Respiratory Distress Syndrome) nicht zu fassen ist. Die DGP unterscheidet in ihrem kürzlich veröffentlichten Positionspapier drei Phasen der Erkrankung: Der frühen Infektion, die blande verläuft und nach der für 80 % der Patienten der Spuk auch schon vorüber ist, schließt sich nach etwa acht Tagen die pulmonale Erkrankung an.
Jetzt beginnt die Virusreplikation in der Lunge, als kennzeichnendes klinisches Symptom tritt Fieber auf. Im Röntgenbild, ggf. ergänzt durch eine Thorax-CT, zeigen sich erste Infiltrate. Die meisten Patienten müssen jetzt stationär behandelt werden, etwa 5 % aller Patienten erkranken so schwer, dass sie auf die Intensivstation verlegt werden müssen.
Die pulmonale Phase dauert etwa von Tag 8 bis Tag 12 und entscheidet über den weiteren Verlauf: „Da gewinnt das Immunsystem und das Fieber sinkt oder die Inflammation läuft durch“, erklärte Professor Dr. Torsten Bauer, Chef der Pneumologie an der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin, der das Papier gemeinsam mit DGP-Präsident Professor Dr. Michael Pfeifer, Klinik Donaustauf in Regensburg, online vorstellte.
Das DGP-Positionspapier
Engmaschiges Monitoring ist zwingend erforderlich
Weil die pulmonale Phase kritisch ist und differenzierte Therapieentscheidungen zu treffen sind, wird noch einmal unterschieden in Phase IIa, in der Gasaustausch und Sauerstoffsättigung zunehmend schlechter werden, der Patient aber noch nicht hypoxämisch und klinisch stabil ist, und Phase IIb mit Dyspnoe, einem kritischen Abfall der Sauerstoffsättigung und zunehmender Herzkreislaufsymptomatik. „In dieser Phase ist eine sehr schnelle Verschlechterung möglich“, so Prof. Bauer. Ein engmaschiges Monitoring ist zwingend erforderlich. Wirklich dramatisch wird es, wenn der Organismus die Entzündung nicht limitieren kann und etwa sieben Tage nach Fieberbeginn die hyperinflammatorische Phase beginnt. Sie geht mit einem Zytokinsturm einher, wobei sich vor allem erhöhte Spiegel von Interleukin-6 und Ferritin, aber auch D-Dimere und Troponin als Marker für eine ungünstige Prognose erwiesen haben. Die beiden Kollegen plädierten für eine „apparative Differenzialtherapie“ – die invasive Beatmung für alle ist sicher nicht die richtige Strategie. Viele Patienten stabilisieren sich bereits, wenn sie Sauerstoff per Nasensonde bekommen. Als nächste Schritte kommen Highflow-O2 oder nicht-invasive Beatmung mit oder ohne Überdruck infrage, bevor der Patient sediert und intubiert wird. Das bedeutet aber nicht, dass die invasive Beatmung als Ultima Ratio anzusehen ist, betonte Prof. Pfeifer: „Wenn wir zu spät damit beginnen, steigt die Sterblichkeit.“ Rechtzeitig in die invasive Beatmung einzusteigen, kann Leben retten. Orientieren sollte man sich bei der Entscheidung nicht allein an den Ergebnissen der arteriellen oder kapillären Blutgasanalyse, sondern auch am klinischen Bild. Für die Entscheidungen im Therapieverlauf schlägt die DGP einen überschaubaren Algorithmus vor (s. Abb.). Wichtig dabei: Der Erfolg der Maßnahmen muss in kurzen Abständen kontrolliert und die Therapie ggf. eskaliert werden. Prof. Bauer hält 30 bis 60 Minuten für angemessen, je nach klinischem Zustand des Patienten.Sicherheit von Ärzten und Pflegenden ist essenziell
Der in letzter Zeit immer wieder laut werdenden Kritik, COVID-19-Patienten würden leichtfertig intubiert und kämen dadurch zu Schaden, trat Prof. Pfeifer klar entgegen: „Die Beatmung ist nicht die Ursache, dass Patienten sterben.“ Er erinnerte auch daran, dass es in der Regel besonders kranke Patienten sind, die beatmet werden müssen. Deren Sterberisiko ist von Natur aus höher. Dauerhafte Schäden an der Lunge seien durch COVID-19 eher zu befürchten als durch die Beatmung. Besonderes Gewicht legen die Autoren des Papiers auch auf die Sicherheit von Ärzten und Pflegenden. „Es ist essenziell und möglich, die Mitarbeiter vor der Ansteckung zu schützen“, so Prof. Pfeifer. Bisher gebe es auch keine Hinweise auf gehäufte Infektionsraten unter medizinischem Personal. Das Papier gibt detaillierte Hinweise, welche Prozeduren mit einer hohen Aerosolbildung einhergehen und wie diese sich durch geeignete Technik minimieren lässt. Im Übrigen lässt sich die Aerosoldichte einfach dadurch verringern, dass man das Fenster öffnet. Das höchste Risiko besteht naturgemäß in dem Moment der Intubation, für den besondere Schutzvorschriften gelten. Ansonsten appellierte Prof. Bauer, den gesunden Menschenverstand einzuschalten: „Wenn ich nahe am Patienten bin, brauche ich Augen-, Mund- und Nasenschutz.“Quelle: DGP-Onlinepressekonferenz