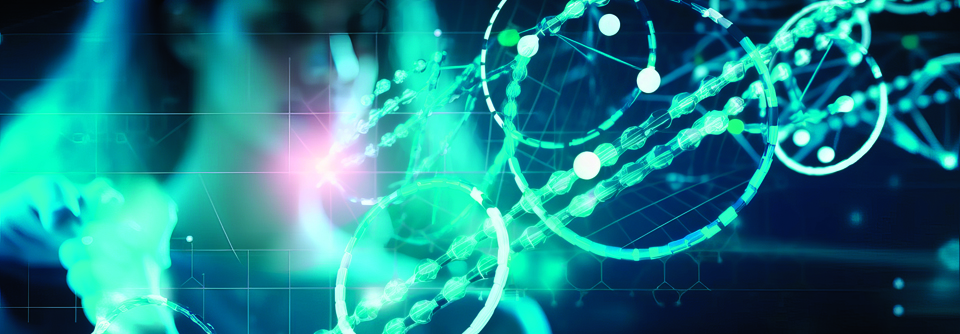Diabetes und Depression Folgenschweres Zusammenspiel
 Eine Depression bei Menschen mit Typ-2-Diabetes sollte als eine Hauptkomplikation der Erkrankung gewertet werden.
© fotoduets – stock.adobe.com
Eine Depression bei Menschen mit Typ-2-Diabetes sollte als eine Hauptkomplikation der Erkrankung gewertet werden.
© fotoduets – stock.adobe.com
„Kannst du dem Patienten vielleicht noch etwas für die Stimmung ansetzen?“ Diese Frage höre ich immer wieder von besorgten Pflegenden. Der hektische Klinikalltag ist geprägt von schnellen Visiten, kurzen Patientenkontakten und jeder Menge organisatorischer Aufgaben. Bei diesem Ablauf ist es nur selten möglich, sich mit einem Patienten oder einer Patientin lange genug zu unterhalten, um ein Gespür für das mentale Wohlbefinden des Gegenübers zu bekommen.
Umso wertvoller sind die Hinweise von anderen Mitgliedern des versorgenden Teams oder auch von Angehörigen. Schließlich beeinflusst das psychische Wohlbefinden bekanntermaßen auch die physische Gesundheit. Allein die Depression ist ein wichtiger unabhängiger Risikofaktor und ein negativer prognostischer Indikator für viele chronische Krankheiten wie Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs und Diabetes. Depressionen können aber auch erst im Rahmen dieser Krankheiten und im Zusammenhang mit den mit ihnen einhergehenden Belastungen entstehen. Diabetes mellitus erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Erkrankung und ein stetiges Diabetes-Management.
Diabetes kann depressive Symptome triggern
Das kann für Betroffene sehr anstrengend sein und stetig Stress erzeugen. Dieser kann wiederum das physische als auch das psychische Wohlbefinden beeinflussen. Der Verlust der Gesundheit und Fitness sowie soziale Faktoren und biologische Ursachen können bei Personen mit Diabetes mellitus Typ 2 die Entstehung einer Depression verursachen.
In unterschiedlichen Studien konnte bereits gezeigt werden, dass Diabetes mellitus als Trigger für das Entstehen oder die Verschlechterung depressiver Symptome fungieren kann. Die Depression selbst beeinflusst möglicherweise die Selbstfürsorge und den Lebensstil insbesondere in Bezug auf die Ernährung und Bewegung. So war in einer Studie eine Verbesserung der depressiven Symptomatik mit einer Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 assoziiert.
Ist Depression eine Hauptkomplikation?
Wissenschaftler diskutieren eine mögliche bidirektionale Beeinflussung von Diabetes mellitus und Depression. Rossella Messina, Forscherin in der Abteilung Biomedizinische und Neuromotorische Wissenschaften an der Universität Bologna, und ihre Kolleg*innen stellen nun die Frage, ob die Depression als eine der Hauptkomplikationen von Diabetes mellitus wahrgenommen werden sollte.
Grundlage für diese Fragestellung bildet die kürzlich im Fachmagazin Acta Diabetologica veröffentlichte Studie von Messina und Kolleg*innen. Im Rahmen einer bevölkerungsbezogenen, retrospektiven Kohortenstudie untersuchte die Arbeitsgruppe die Daten von 30.815 Menschen, welche kürzlich mit Diabetes mellitus Typ 2 diagnostiziert worden waren. Die Ergebnisse zeigten, dass 16,7 % dieser Menschen im Verlauf von 10 Jahren mit einer Depression diagnostiziert wurden. Insbesondere Frauen und Menschen älter als 65 Jahre waren hiervon betroffen. Auch das Leben in ländlichen Gebieten und das Vorhandensein weiterer Erkrankungen zeigte sich mit dem Auftreten einer Depression assoziiert. Bei der Untersuchung von akuten Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes mellitus zeigte sich, dass diese häufiger auftreten, wenn Patient*innen ebenfalls an einer Depression litten. Während der gesamten Beobachtungszeit von 10 Jahren starben 26,2 % der Proband*innen mit einer Depression und 13,5 % der Proband*innen ohne Depression. Die Autor*innen schlussfolgern aus diesen Ergebnissen, dass eine Depression bei Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 als eine Hauptkomplikation der Erkrankung gewertet werden sollte, da sie zu einem schwerwiegenderen Krankheitsverlauf führen kann.
Es gilt jedoch zu bedenken, dass Messina und ihr Team in der Studie von dem Vorhandensein einer Depression ausgingen, wenn diese sich unter den Diagnosen befand und/oder die Patient*innen Antidepressiva einnahmen. Antidepressiva werden jedoch nicht ausschließlich für die Behandlung von Depressionen verwendet, sondern auch bei Angststörungen, Schlafstörungen oder chronischen Schmerzen eingesetzt. Zudem konnten diejenigen, die nicht aufgrund ihrer Depression behandelt wurden, und jene, die beispielsweise eine psychotherapeutische Behandlung privat zahlen, durch das Studiendesign nicht erfasst werden.
Dennoch unterstreicht die Arbeit von Messina und ihren Kolleg*innen erneut den Zusammenhang von chronischen somatischen Erkrankungen und der Psyche. Ein Faktor, der in der klinischen Praxis mehr Beachtung finden sollte, um Menschen eine umfassendere Behandlung zukommen lassen zu können.
Literatur: Messina R et al. Acta Diabetol 2022; 59: 95-104; DOI: 10.1007/s00592-021-01791-x