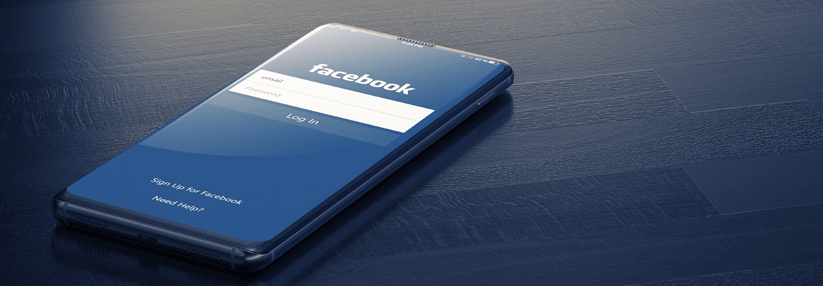Sex und Social Media Digitale Selbsterkundung mit fatalen Folgen
 Privatsphäreeinstellungen sind wichtig, bieten aber keinen wirklichen Schutz.
© oatawa – stock.adobe.com
Privatsphäreeinstellungen sind wichtig, bieten aber keinen wirklichen Schutz.
© oatawa – stock.adobe.com
Soziale Medien sind aus dem Alltag der allermeisten Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. „Deshalb sollte man immer danach fragen, welche Angebote junge Patienten nutzen und in welcher Form“, erklärte die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Lisa Kehler aus Cuxhaven. Grundsätzlich sprechen soziale Netzwerke viele Bedürfnisse junger Menschen an: Den Wunsch nach Orientierung und Zugehörigkeit, die Möglichkeit, kreativ zu sein sowie einfach Ablenkung und Entspannung. Während der Coronapandemie konnten soziale Medien in Sachen Freundschaft und Beziehungspflege einiges auffangen. Doch vor allem für Jugendliche lauern im Netz auch Fallstricke und Gefahren.
Von Fake News bis Cybermobbing
Als Beispiele erwähnte die Expertin etwa die Verbreitung unrealistischer Schönheitsideale u.a. auf Instagram und TikTok, die oft nur durch eine aufwendige Inszenierung und Bearbeitung der Inhalte möglich ist. Hinzu kommen spezielle Kanäle zu Themen wie Depression oder Anorexie, die für anfällige Nutzer Gefahren bergen, sowie schon länger diskutierte Probleme wie Fake News, Pornografie oder Cybermobbing.
Eine besondere Rolle, gerade nach mehr als zwei Jahren Pandemie, spielen soziale Medien auch für die Sexualität von Jugendlichen. „Sexting“ nennt sich das Verschicken und Tauschen von Nacktaufnahmen per Internet oder Mobiltelefon. Kehlers Erfahrung nach gibt es einen großen Druck unter den Gleichaltrigen, solche Entwicklungen mitzumachen und ebenfalls Nacktbilder („Nudes“) zu verschicken. Für sexualisierte Nachrichten ist vor allem Snapchat beliebt. Leicht zu nutzende Filter erlauben es den Jugendlichen, sich auszuprobieren und sich etwa auf verschiedene Arten als sexy darzustellen. Die Aufnahmen werden zum Flirten genutzt, als Liebes- oder Vertrauensbeweis in einer Beziehung oder schlicht als Antwort auf ein erhaltenes Bild. Die in immer mehr Apps enthaltene Option, dass sich Nachrichten nach einer bestimmten Zeit selbst löschen, bietet nur eine scheinbare Sicherheit. Denn der Empfänger kann davon einfach einen Screenshot machen und diesen im Zweifelsfall weiterleiten. Kehler berichtete von einem jungen Mädchen, deren Exfreund nach der Trennung Nacktbilder von ihr verschickte, die sich im Nu an der ganzen Schule und später noch an einer anderen Schule verbreiteten.Juristisch spricht nichts gegen das Sexting als freiwillige Handlung zwischen sexuell mündigen Jugendlichen, wenn es zum persönlichen Gebrauch und mit Einwilligung erfolgt. Das Weiterschicken von Bildern ist aber strafbar, betonte Kehler. Hinweise zum „Safer Sexting“, zum Beispiel durch bestimmte Privatsphäreeinstellungen in den Apps sind zwar wichtig, bieten aber keinen wirklichen Schutz.
Die Therapie sollte den Betroffenen einer solchen bildbasierten sexualisierten Gewalt einen sicheren Raum bieten – ohne Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Diese Haltung sollte man auch den Eltern vermitteln. Essenziell ist in jedem Fall die Beurteilung von Fremd- und Selbstgefährdung: Im geschilderten Fall wollte sich das Mädchen das Leben nehmen, nachdem sie erlebt hatte, welche Macht ihr Exfreund mit den Fotos über sie hatte. „Bleiben Sie dran, auch wenn Betroffene plötzlich Hilfe ablehnen“, empfahl Kehler. Es gelte, die Opfer zum Handeln zu ermutigen, etwa die Aufnahmen zu melden und den betreffenden Account sperren zu lassen. Bei der Frage, ob Anzeige erstattet werden sollte, müsse man detailliert die Vor- und Nachteile besprechen, um keine zusätzliche Traumatisierung zu riskieren.
Für die Therapie nutzt Kehler ein „Teilekonzept“ zur Ressourcenaktivierung und zur Entwicklung von Bewältigungsstrategien: „Nur ein bestimmter Teil dessen, was ich bin, wurde verletzt.“ Auch Sicherheitsmaßnahmen für den Umgang mit sozialen Medien sollten vermittelt werden. Das bedeutet, vor jedem Verschicken eines Fotos zu reflektieren, was Freunde oder Familie zu der Aufnahme sagen würden, wenn diese öffentlich werden sollte.
Zur Rückfallprophylaxe an gute Freunde wenden
Kam es zu einer unerwünschten Weiterleitung von Bildern, braucht man eine Rückfallprophylaxe: Oft tauchen die Fotos nach der ersten Verbreitungswelle erneut irgendwo im Netz auf. Kehler empfiehlt etwa die Methode, eine gute Freundin zu bitten, von Zeit zu Zeit online nach den Aufnahmen zu fahnden. Wenn sie tatsächlich noch einmal veröffentlicht wurden, muss das Opfer dies nicht zufällig entdecken und damit alleine bleiben. Ein wichtiges Therapieziel ist zudem die Stärkung der sozialen Kompetenz: Viele Betroffene müssen lernen, besser Grenzen zu setzen und Nein sagen zu können. Egal, wie verliebt sie sind oder wie groß der soziale Druck sein mag.
Kongressbericht: DGPPN* Kongress 2022
* Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde