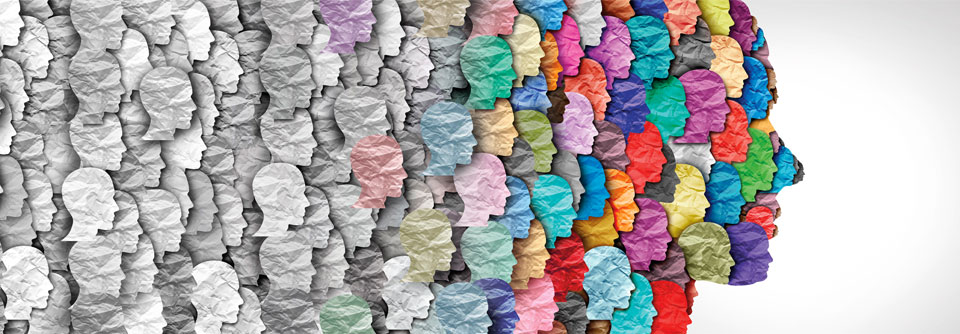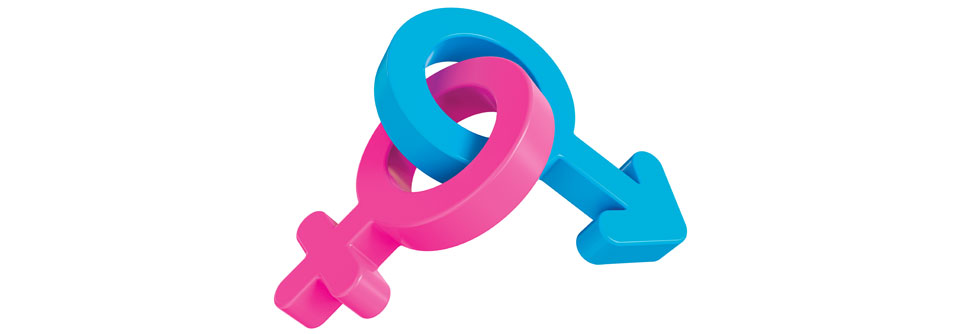Forschung zu Gendermedizin für Kinder und Jugendliche gefordert
 Die Gesellschaft sei gefordert überzeugende Leitbilder zu vermitteln und Jungen dabei zu unterstützen, eine positive männliche Identität zu entwickeln. (Agenturfoto)
© iStock/Sneksy
Die Gesellschaft sei gefordert überzeugende Leitbilder zu vermitteln und Jungen dabei zu unterstützen, eine positive männliche Identität zu entwickeln. (Agenturfoto)
© iStock/Sneksy
Die Forschung auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin lässt genderspezifische Analysen vermissen, bemängelt der Hamburger Kinder und Jugendarzt Dr. Bernhard Stier. Damit werde die Chance auf eine zielgenaue genderspezifische Arbeit verpasst. Das betreffe nicht zuletzt die Prävention von Risikoverhalten.
Jungen und Mädchen wachsen in einem langen prägenden Prozess in ihre Geschlechtsidentität hinein. Allerdings sind die Rollenbilder im Wandel begriffen, wobei tradierte und moderne Vorstellungen miteinander kollidieren.
Gesellschaft muss gesundes Aufwachsen ermöglichen
Was ist männlich? Wie sollte ein Mann sein, wie sollte er sich verhalten? Fragen, die sich heutzutage kaum verbindlich beantworten lassen. Entsprechend schwer fällt es Jungen, sich zu orientieren. Die Gesellschaft sei gefordert, so Dr. Stier, überzeugende Leitbilder zu vermitteln und Jungen in der schwierigen Aufgabe zu unterstützen, eine positive männliche Identität zu entwickeln. „Jungen gestalten ihre Männlichkeit aus dem sozialen Material, das sie vorfinden“, sagt der Pädiater. Und weiter: Aus Jungen werden Männer, und wenn die Gesellschaft – einschließlich der politisch Verantwortlichen – nicht dafür sorgt, den Jungen ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen, dürfe sie sich nicht wundern, wenn problematische Bewältigungsstrategien und Handlungsweisen zunehmen, die Jugendliche gegen sich selbst oder gegen die Gesellschaft richten.
Einige Mythen erschweren Jungen eine Identitätsfindung noch zusätzlich. Ein Paradebeispiel; die immer noch verbreitete Ansicht, das männliche Geschlecht sei aggressiver und neige eher zur Gewalt, was mit dem Testosteronspiegel zusammenhänge. Eine entsprechende Wirkung des Hormons ist längst widerlegt, doch das Vorurteil hält sich hartnäckig. Und das hat Auswirkungen auf die „Atmosphäre“, in der Jungen aufwachsen. Spontan nimmt man sie immer eher als Täter denn als Opfer wahr. Bei genauem Hinsehen jedoch gibt es dafür keine Evidenz, im Gegenteil. Jungen erleben sehr häufig körperliche Gewalt, zum Beispiel im häuslichen Umfeld, wo sie sie eher trifft als Mädchen. Auch sonst wird man laut Dr. Stier den Realitäten in keiner Weise gerecht, wenn man die Opferrolle von Jungen ignoriert oder gering einstuft.
Das gelte nicht zuletzt auch für sexualisierte Gewalt. Allgemeine Studien gehen davon aus, dass jeder fünfte bis zehnte Junge sexuellen Missbrauch erlebt. Dunkelfeldstudien zufolge liegt die Inzidenz sogar noch höher. Doch nur wenige der Betroffenen bekommen Hilfe, nicht zuletzt weil das Thema in der Öffentlichkeit wenig Beachtung findet.
Die Gewalterfahrungen hinterlassen ihre Spuren, auch wenn viele Kinder und Jugendliche die Erlebnisse erst einmal wegzudrücken scheinen. Später jedoch können vielfältige psychische Beeinträchtigungen zutage treten, die von überkompensatorischem Männlichkeitsgebaren bis hin zu schweren Depressionen reichen.
Gewalterfahrungen stören die Entwicklung der Sexualität
Ein weiteres Vorurteil lautet: Männer, die in der Jugend gewaltsamen Übergriffen ausgesetzt waren, neigen als Erwachsene selbst zur Gewalttätigkeit. Falsch, sagt Dr. Stier. Vielmehr hätten Gewaltopfer häufig Angst davor, ihre Erfahrungen zu reproduzieren und würden sich gehemmt verhalten. Das eigene Männlichkeitsbild ist bei Gewaltopfern sehr vulnerabel und die Entwicklung einer „normalen“ männlichen Sexualität immer gestört.
Das Konfliktpotenzial, das Gewalterfahrungen von Jungen für die Betroffenen selbst und für die Gesellschaft bergen, lässt sich nur erahnen. Genderspezifische Studien zu diesem und anderen Aspekten seien überfällig. Mehr noch: Dr. Stier würde es begrüßen, wenn alle Studien im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin nach Geschlechtern differenzieren würden. Nur so ließe sich eine Datenbasis generieren, aus der sich – letztlich gesellschaftsrelevante – Handlungsstrategien ableiten lassen.
Quelle: Stier B. Kinder- und Jugendarzt 2021; 5 2: 254-257