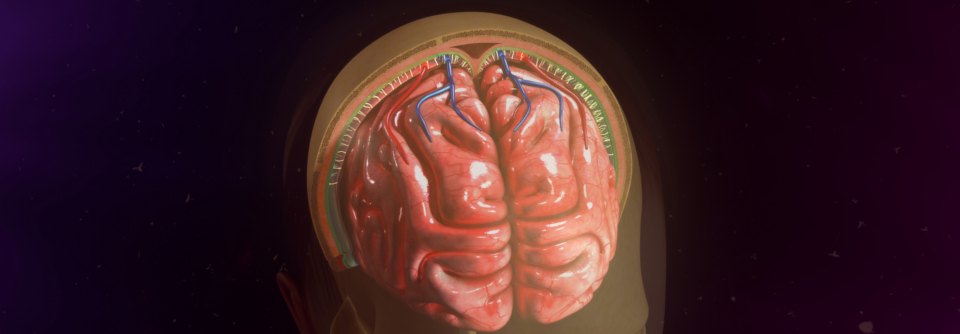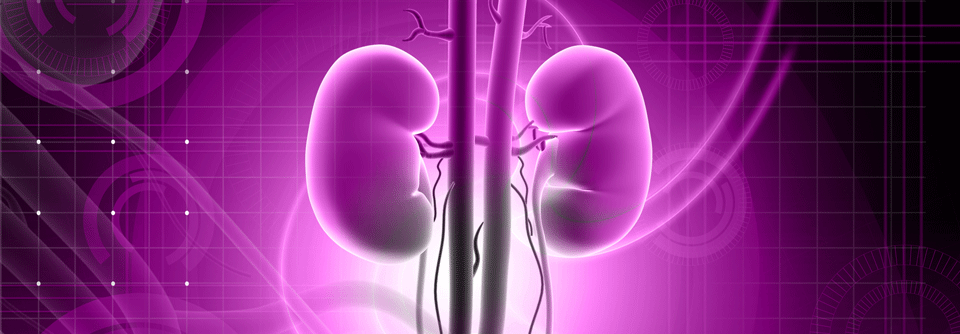Hirsutismus lässt sich oft schon durch eine Lebensstiländerung reduzieren
 Bei jüngeren Betroffenen liegt meist ein polyzystisches Ovarialsyndrom vor.
© iStock.com/lekcej
Bei jüngeren Betroffenen liegt meist ein polyzystisches Ovarialsyndrom vor.
© iStock.com/lekcej
Mit Hirsutismus und Zyklusstörungen stellt sich eine 20-Jährige im Universitätsspital Basel vor. Seit ihrer Menarche mit 11 Jahren habe sie unregelmäßig ihre Menstruation (5–6 pro Jahr). Bereits mit 14 bemerkte sie vermehrten Haarwuchs an Oberlippe und Kinn. Er habe genau wie ihr Gewicht in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Medikamente nimmt die Frau nach eigenen Angaben keine. Ihre Haut wirkt fettig mit akneiformen Läsionen im Gesicht. Bei den Laborwerten liegt sowohl die freie als auch die totale Testosteronkonzentration deutlich über der Norm. Die körperliche Untersuchung ergibt einen BMI von 28 kg/m2, einen arteriellen Blutdruck von 142/88 mmHg und einen moderaten Hirsutismus ohne Virilisierung.
Hirsutismus ist eine der häufigsten weiblichen endokrinen Störungen. Definiert als männlicher Behaarungstyp bei Frauen, ist er das Zeichen einer vermehrten Androgenwirkung und häufig mit einer Hyperandrogenämie assoziiert. Die sprießenden Härchen an Oberlippe, Kinn, Brust oder Rücken machen vielen Betroffenen psychisch zu schaffen und können bis hin zu Depressionen oder Angststörungen führen. Eine Hyperandrogenämie kann zusätzlich auch eine Infertilität bewirken und das kardiovaskuläre Risiko erhöhen.
In über 70 % der Fälle ist bei prämenopausalen Frauen ein polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS) verantwortlich, schreiben Dr. Fahim Ebrahimi und seine Kollegen von der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Metabolismus des Universitätsspitals Basel.
Sowohl das totale als auch das freie Testosteron messen
In der Postmenopause kann aber auch mal ein Tumor hinter dem abnormalen Haarwuchs stecken, weshalb dieser immer abgeklärt werden muss. Sogar wenn die notwendigen Kriterien zur PCOS-Diagnose (s. Kasten) erfüllt sind, sollten Sie folgende Differenzialdiagnosen ausschließen:
- Medikamentenwirkung
- Schwangerschaft
- „late-onset“ androgenitales Syndrom (AGS) oder AGS
- idiopathischer Hirsutismus
- androgen-sezernierender Tumor
- Cushing-Syndrom
- Hyperprolaktinämie
- Hypothyreose
Rotterdam-Kriterien
- Hyperandrogenismus (klinisch, biochemisch oder beides)
- ovulatorische Dysfunktion
- polyzystische Ovarien
Rasche Progredienz und hohe Werte deuten auf einen Tumor
Eine zusätzliche Messung des 17-OH-Progesteron-Werts wird empfohlen, wenn trotz normwertiger Testosteronwerte der Verdacht auf eine „late-onset“ AGS besteht (positive Familienanamnese oder Zugehörigkeit zu einer Hochrisikoethnie). Zudem sollte bei Frauen im gebärfähigen Alter mit Amenorrhoe immer ein Schwangerschaftstest durchgeführt werden. Einen ovariellen oder adrenalen Tumor sollte man insbesondere bei einer rasch progredienten Symptomatik oder Virilisierungszeichen sowie deutlich erhöhten Werten für totales Testosteron in Betracht ziehen. Im Falle der 20-jährigen Patientin aus der Kasuistik diagnostizierten die Ärzte nach Ausschluss der Differenzialdiagnosen anhand des Hyperandrogenismus und der Oligomenorrhoe ein polyzystisches Ovarialsyndrom. Wie sie leiden Frauen mit PCOS häufig auch an einem metabolischen Syndrom mit Hyperinsulinämie. Deswegen kann bereits eine Lebensstil-Modifikation mit Gewichtsreduktion zu einer deutlichen Besserung des Hirsutismus führen. Die 20-Jährige erhielt unterstützend Metformin gegen die Hyperinsulinämie. Alternativ könnte man auch auf Spironolacton oder Finasterid ausweichen.Antiandrogen-Therapie ist potenziell teratogen
Eine medikamentöse Behandlung sollte primär die Androgenproduktion reduzieren bzw. die Androgenwirkung am Haarfollikel hemmen. Besteht kein akuter Kinderwunsch, empfehlen Dr. Ebrahimi und Kollegen bei PCOS kombinierte orale Kontrazeptiva. Reicht die Wirkung nicht aus, kann ein zusätzliches antiandrogen wirkendes Präparat erwogen werden. Generell ist während der Antiandrogen-Therapie aufgrund der potenziellen Teratogenität unbedingt auf eine zuverlässige Kontrazeption (Spirale oder „progestin-only“-Pille) zu achten. Bei einer Kontraindikation werden mechanische Haarentfernungsmethoden (lokal-kosmetische, Lasertherapie, Elektrolyse) empfohlen.Quelle: Ebrahimi F et al. Swiss Med Forum 2018; 18: 981-988