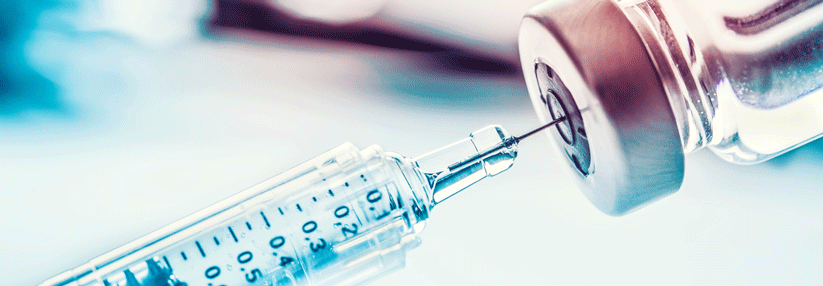Nach der Intensivstation Persistierende Morbidität nach kritischer Krankheit im Auge behalten
 Bei vielen Patienten bleiben chronische Probleme verschiedener Art zurück.
© Peakstock – stock.adobe.com
Bei vielen Patienten bleiben chronische Probleme verschiedener Art zurück.
© Peakstock – stock.adobe.com
Auf das Problem langfristiger Folgen einer kritischen intensivmedizinisch behandelten Erkrankung wurde man in Zusammenhang mit dem akuten respiratorischen Distress-Syndrom (ARDS) aufmerksam. Zu den Folgen gehören nicht nur bleibende Einschränkungen der Lungenfunktion, sondern auch neurokognitive Defizite. Bei 30 % der ARDS-Überlebenden fand sich nach einem Jahr eine persistierende kognitive Dysfunktion. Später sah man derartige Befunde auch bei anderen Überlebenden von Intensivstationen, schreiben Prof. Dr. Margaret Herridge von der Interdepartmental Division of Critical Care Medicine an der Universität von Toronto und Dr. Élie Azoulay von der Médecine Intensive et Réanimation am Hôpital Saint-Louis in Paris.
Die kognitiven Beeinträchtigungen sind unabhängig vom Alter und entsprechen im Schweregrad einer milden Alzheimer-Demenz. Sie beruhen auf einer Schädigung von Kortex und/oder weißer Substanz. Als Hauptrisikofaktor wird die Dauer des Deliriums in der Akutphase betrachtet, daneben können Hypoxämie, Blutzuckerdysregulation und andere Faktoren dazu beitragen.
Beschrieben werden darüber hinaus anhaltende funktionelle Einschränkungen als Folge der muskulären Schwäche in der Akutphase. Eine Abnahme der 6-Minuten-Gehstrecke war noch 5 Jahre nach der Entlassung aus der Intensivstation (Intensive Care Unit, ICU) ein Faktor, der die gesundheitsbezogene Lebensqualität einschränkte und dazu beitrug, dass die Patienten die medizinische Versorgung verstärkt in Anspruch nahmen.
Die Muskelschwäche beeinträchtigt nicht nur das Gehen, es drohen auch Schluckstörungen mit Aspirationsgefahr. Schlimmstenfalls resultiert eine allgemeine Gebrechlichkeit (frailty), die Betroffene ihre Unabhängigkeit kosten kann.
Besonders von Muskelschwäche betroffen sind Frauen, Patienten mit vielen Komorbiditäten und solche, die systemische Steroide erhalten hatten. Mehrere Untersuchungen bestätigen ein jahrelang anhaltendes physisches Defizit bei ARDS-Überlebenden. Der auf einer ICU erworbenen Schwäche liegt eine Myopathie durch Myosin-Depletion und/oder eine Polyneuropathie zugrunde. Kurzfristig bedingt diese muskuläre Schwäche eine verlängerte Beatmungszeit und einen entsprechend längeren Aufenthalt auf der Intensivstation. Zudem gestaltet sich der Übergang in die Nachsorge schwierig. Langfristig kann dieses Problem immer wieder zu erneuten Krankenhausaufnahmen führen.
Viele Überlebende einer kritischen Krankheit entwickeln auch psychische Probleme. Etwa ein Viertel leidet bis zu acht Jahre nach der Akutphase an einer posttraumatischen Belastungsstörung, bis zu rund 40 % zeigen eine Depression und Angstsymptome. Möglicherweise lassen sich diese Probleme auf eine Schädigung des limbischen Systems in der Akutphase zurückführen. Als Risikofaktoren für psychische Folgekrankheiten wurden unter anderen eine überdurchschnittlich lange mechanische Beatmung, Hypoglykämieepisoden und der längere Einsatz von Sedativa und Narkotika ermittelt.
Das Ausmaß der Langzeitfolgen nach einem Aufenthalt auf der ICU und die Rate der späteren Mortalität hängt von vorbestehenden Komorbiditäten, dem Alter des Patienten, der Länge des Aufenthalts auf der Intensivstation bzw. der mechanischen Beatmung, dem Schweregrad der muskulären Schwäche und dem funktionellen Status bei Entlassung ab. In einer Untersuchung betrug die Mortalität bei Patienten über 66 Jahre, die mindestens zwei Wochen auf der Intensivstation verbracht hatten, nach einem Jahr 40 %. Der Großteil der Überlebenden litt unter erheblichen Beeinträchtigungen.
Insgesamt muss die Tatsache, dass die kritische Krankheit selbst nur eine Phase des gesamten Krankheitsprozesses darstellt, in der medizinischen Versorgung noch stärker wahrgenommen werden, fordern die Autoren. Der Job ist nicht mit künstlicher Beatmung und hämodynamischer Unterstützung erledigt. Die zahlreichen drohenden psychischen und körperlichen Probleme bedürfen der langfristigen Betreuung, mahnen sie.
Sie raten, die Dauer einer Intensivtherapie zu begrenzen und das Ziel bei kritisch kranken Patienten in Absprache mit den Angehörigen nach zwei Wochen wöchentlich anzupassen. Auch die Familienangehörigen des vormals kritisch Kranken dürfen in einem umfassenden Nachsorge-Management des „Post-ICU-Syndroms“ nicht vergessen werden. Denn bei ihnen beobachtet man ebenfalls gehäuft Angst, Depression, posttraumatische Belastungsstörung und Stress.
Quelle: Herridge MS, Azoulay É. N Engl J Med 2023; 388: 913-924; DOI: 10.1056/NEJMra2104669