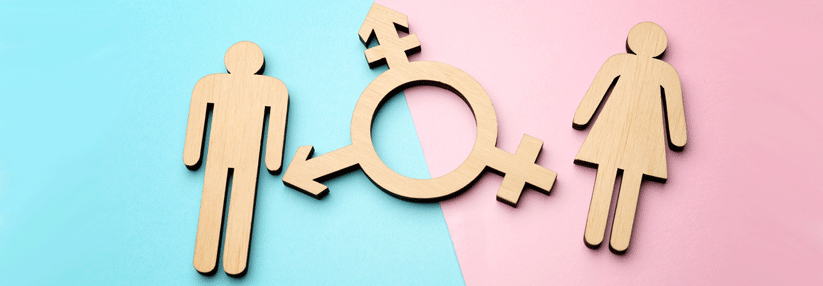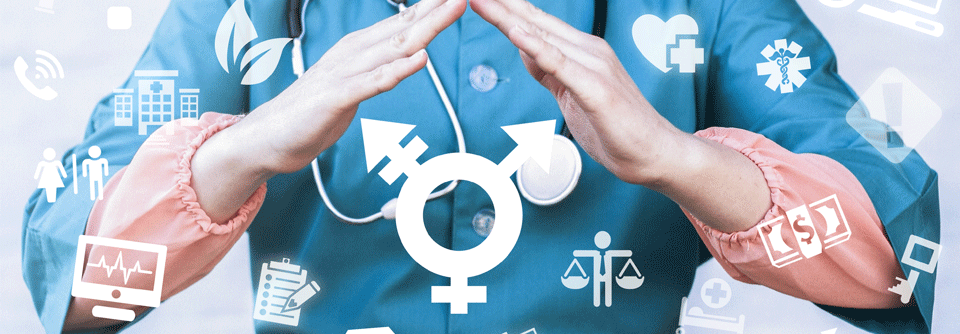Sind Sie homo-, bi- oder transsexuell?
 Die Sexualität des Patienten kann bei der Behandlung eine Rolle spielen. Ist es aber notwendig, jeden danach zu fragen?
© fotolia/nito
Die Sexualität des Patienten kann bei der Behandlung eine Rolle spielen. Ist es aber notwendig, jeden danach zu fragen?
© fotolia/nito
Jahrzehntelange Kampagnen von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender haben dazu beigetragen, dass in Großbritannien die sexuelle Orientierung ein geschütztes Gut ist. Die nationale englische Gesundheitsbehörde schlägt daher nun vor, jeden Patienten danach zu fragen. Für Richard Ma von der School for Public Health am Imperial College London ein logischer Schritt. Immerhin: „Die Patienten können sich natürlich weigern zu antworten.“
Er findet, um einen Patienten, der sich als schwul, bisexuell oder transsexuell versteht, wirklich gut zu behandeln, müsse man darum wissen. „Wir werden der LGBT-Community“ – die englische Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender – „schon jetzt nicht gerecht, weil wir ihre speziellen medizinischen Bedürfnisse weder richtig wahrnehmen noch anerkennen.“
Seelische Probleme, HIV und Drogengebrauch
Die Suizidquote unter jungen homo- und bisexuellen Männern sei sechsmal so hoch wie unter gleichaltrigen Heteros. LGBT-Patienten konsumieren mehr Alkohol, Zigaretten und Drogen – zudem benötigen sie auch mehr Aufmerksamkeit beim Thema HIV-Test: „Ethnizität beinhaltet mehr als die Farbe der Haut, Geschlecht mehr als die Chromosome“, und deshalb gehe es bei der Frage nach der Orientierung auch nicht nur um Sex.
Er könne verstehen, dass sich manche Kollegen schwer tun, mit solchen Erkundigungen tief in das Privatleben ihrer Patienten vorzustoßen. „Aber wir sollten uns auch fragen: Warum haben wir dieses Gefühl und warum möchten uns manche Menschen diese Informationen nicht verraten?“ Weder das eine noch das andere hält der Autor noch für zeitgemäß. Stattdessen fordert er: „Wir sollten unsere Umgebung so gestalten, dass niemand Bedenken haben muss, über das Thema zu reden. “
Sexualität ist und bleibt für viele Privatsache
Auch Allgemeinmediziner Michael Dixon bezweifelt nicht, dass die sexuelle Orientierung eines Patienten eine wichtige Information für die Therapieentscheidung sein kann. „Und es gibt viele Gelegenheiten, wo es für einen Arzt durchaus angebracht ist, danach zu fragen.“ Aber dies bei jedem Patienten und bei jeder Gelegenheit zu tun, nennt er „verrückt gewordene political correctness“.
„Wenn ich in meiner Praxis solche Dinge meine 17- oder 70-jährigen Patienten frage“, schreibt der Allgemeinarzt aus dem britischen Devon, „denkt der eine, ich werde langsam seltsam, und der andere glaubt, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank.“ Auch wenn es eine Anweisung dafür gäbe, würde der Hinweis darauf die Dinge kaum zum Guten wenden. „Denn dann werden sich meine Patienten vielleicht zu Recht wundern, ob es mir als Arzt wirklich in erster Linie um ihre Interessen geht. Sexualität ist und bleibt für viele Menschen Privatsache.“
Der Hausarzt lehnt die Vorgabe ab, das macht er mehr als deutlich, für ihn ist sie nur ein weiteres Beispiel für die Überregulierung der Ärzte und die „Erosion der medizinischen Autonomie“. „Wir werden einen weiteren Strom von Kollegen sehen“, so seine Prophezeiung, „die aus unserem Fach fliehen, um solchen dummen Big-Brother-Regeln zu entkommen“.
Good medical practice heißt für den Allgemeinmediziner, „dass an erster Stelle die Bedürfnisse, Wünsche, Entscheidungen, Einstellungen, Perspektiven und die Kultur des Patienten stehen – nicht die Regeln oder Erlässe einer höheren Stelle“. In den Augen von Michael Dixon gibt es deshalb nur eine Instanz, die über den angemessenen Moment für und die Notwendigkeit von derart intimen Fragen entscheiden könne: das Urteilsvermögen des vom Patienten ausgewählten Arztes.
Quelle: Ma R, Dixon M. BMJ 2018; 360: k52