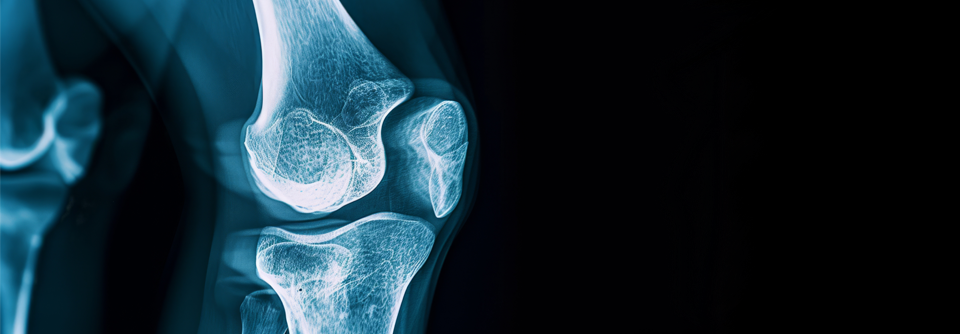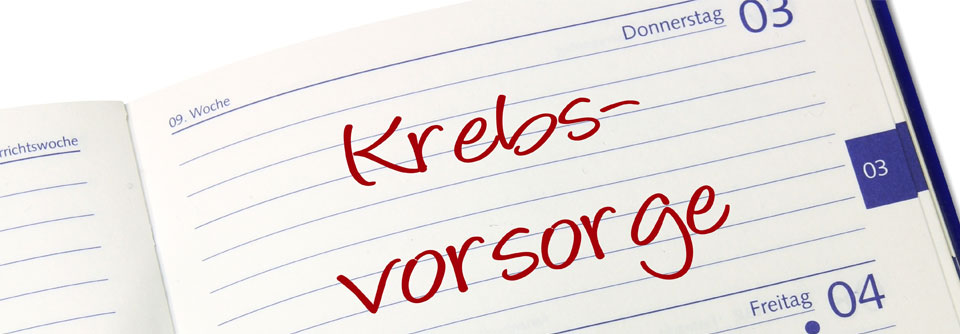Männer vs. Frauen Ungerechtes Rheuma
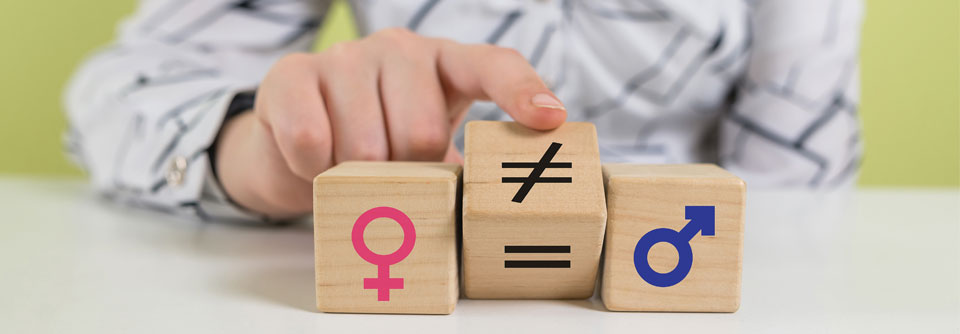 Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich Klinik und Therapie sind eklatant.
© Tania – stock.adobe.com
Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich Klinik und Therapie sind eklatant.
© Tania – stock.adobe.com
Schon die Geschlechtsverteilung rheumatischer Erkrankungen spricht eine deutliche Sprache berichten Dr. Katinka Albrecht und Prof. Dr. Anja Strangfeld vom Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin. Denn Frauen sind in fast allen Entitäten überrepräsentiert, so die Auswertung der bundesweiten Kerndokumentation der Rheumazentren von 2020. Beim Sjögrensyndrom und bei den Mischkollagenosen bilden sie über 90 % des Patientengutes. Von den Lupuspatienten sind 87 % weiblich, von denjenigen mit rheumatoider Arthritis (RA), systemischer Sklerose (SSc) und Riesenzellarteriitis sind es immer noch jeweils gut drei Viertel. In etwa pari verhalten sich die Geschlechterzahlen bei der Psoriasisarthritis (PsA, 52 % Frauen, 48 % Männer). Nur die ankylosierende Spondyloarthritis und der Morbus Behcet zeigen mit 65 % bzw. 64 % Männern ein überwiegend männliches Klientel.
Ein langer Weg zur Diagnose
Frauen erkranken nicht nur häufiger an Rheuma, sie suchen einer kanadischen Studie zufolge in den Jahren vor der Diagnose auch häufiger den Rheumatologen auf. Das nützt ihnen aber offenbar wenig. Denn verschiedene Erhebungen zu axSpA, PsA, SSc und SLE zeigen, dass der Weg der Frauen zur Diagnose deutlich länger ist als der der Männer. Dies scheint, so die Autorinnen, vor allem daran zu liegen, dass die Erkrankungen sich bei Männern häufig typischer präsentieren. So weisen beispielsweise Männer mit axSpA früher radiologische und serologische Veränderungen auf als Frauen; Männer mit PsA zeigen eher eine (typische) Oligo- und Frauen eher eine (untypische) Polyarthritis. Das gilt auch für SSc und SLE. Die SSc betroffener Männern wird deutlich früher erkannt, vermutlich, weil sie schon im frühen Krankheitsstadium eine höhere Krankheitsaktivität und spezifische Antikörper aufweisen. Beim Lupus dürfte die Diagnose dadurch beschleunigt werden, dass Männer häufig schon früh schwere Organbeteiligung erleiden.
Ein weiterer Grund für die Diagnoseverzögerung könnte eine geschlechtsdifferente Erwartung von Symptomen seitens der Ärzte spielen: Diese dokumentierten in einer spanischen Untersuchung – trotz vergleichbarer geschilderter Symptomatik – bei männlichen Patienten deutlich häufiger Rückenschmerzen und bei Patientinnen deutlich häufiger periphere Symptome.
Unterschiedliche Komorbiditäten
Frauen und Männer mit rheumatischen Erkrankungen unterscheiden sich aber auch hinsichtlich der Häufigkeit und Schwere ihrer Komorbiditäten und Organmanifestationen: So haben weibliche Betroffene mit RA häufiger Arthrosen, Osteoporose, Depressionen und Schilddrüsenerkrankungen, männliche dagegen häufiger kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes, Gicht und Niereninsuffizienz. Die kardiovaskulären Komplikationen gehören jedoch zu den Haupttodesursachen von Patienten mit rheumatischen Erkrankungen. Wie die Autorinnen betonen, wurde in einer Untersuchung bei einem guten Drittel der weiblichen, aber nur einem Zehntel der männlichen Rheumapatienten mit einem kardiovaskulären Ereignis das Risiko zuvor als niedrig eingestuft.
Stärkere Krankheitsbelastung
Im Vergleich zu männlichen Betroffenen erwies sich zudem die subjektive Belastung durch eine PsA bei Frauen als höher. Sie geben mehr schmerzhafte Gelenke, intensivere Schmerzen, stärkere Funktionseinschränkungen und mehr Fatigue an. Als mögliche Ursache wird eine Rolle der weiblichen Sexualhormone auf das Schmerzempfinden diskutiert.
Weniger Therapieresponse
In einer niederländischen Früh-PsA-Kohorte zeigte sich, dass Frauen im Vergleich zu Männern kürzer mit Methotrexat behandelt wurden und Männer zudem früher Biologika erhielten. Nach einem Jahr hatten signifikant weniger Patientinnen als Patienten eine niedrige Krankheitsaktivität bzw. Remission erreicht. In einer Studie zur PsA sprachen Frauen schlechter auf den TNF-Inhibitor (TNFi) Etanercept an, und zwar unabhängig davon, welche Scores zur Bewertung eingesetzt wurden.
Bezüglich der Therapieresponse haben auch Komorbiditäten einen Einfluss. Übergewicht reduziert bei Frauen die Wirksamkeit zytokingerichteter Substanzen wie TNFi und Tocilizumab stärker als im Vergleich zu Männern. Keine Hinweise auf geschlechtsspezifische Unterschiede zeigten sich dagegen bisher bei den Januskinase-Inhibitoren.
Oft mehr Nebenwirkungen
Frauen erleiden – unabhängig von der Arzneimittelklasse – häufiger unerwünschte Wirkungen als Männer und sie brechen eine Therapie mit Biologika häufiger ab. Dies könnte nach Ansicht der Autorinnen an Unterschieden in Pharmakokinetik und Körpergewicht liegen, die wiederum Verteilungsvolumen und Clearance beeinflussen. Auch bei anderen Wirkstoffen ist es riskant, weiblich zu sein. Frauen erleiden z.B. unter Allopurinol 1,5-mal häufiger schwere kutane Arzneimittelreaktionen. Nintedanib führt bei ihnen öfter zu Übelkeit, Erbrechen und Transaminasenanstieg. Männer haben dagegen ein höheres Mortalitätsrisiko, wenn ihre prognostisch ungünstige SSc mit einer autologen Stammzelltransplantation behandelt wird.
Auch wenn es in der Rheumatologie keine Evidenz dazu gibt, legen Daten aus der Kardiologie nach Meinung der Autorinnen nahe, dass individuelle Dosierungsschemata unter Berücksichtigung des Geschlechts sinnvoll sein könnten. Therapieempfehlungen oder Grenzwerte für Krankheitsaktivitätsscores, die das Geschlecht berücksichtigen, existieren bislang ebenfalls nicht.
Als Gründe für geschlechtsspezifische Unterschiede bei Diagnose und Therapie rheumatischer Erkrankungen führen die Autoren biologische und soziologische Faktoren an. Neben den Geschlechtshormonen unterscheiden sich bei Männern und Frauen aber auch Organgrößen und -funktionen. Dazu können physiologische Ungleichheiten bei der Schmerzverarbeitung und der Immunität eine Rolle spielen. Außerdem bestehen soziokulturell bedingte Unterschiede zwischen den Geschlechtern, etwa im Gesundheitsverhalten, der Wahrnehmung von Schmerzen und bei den Auswirkungen auf die berufliche Teilhabe – wobei hierzu die Forschung erst am Anfang steht.
Quelle: Albrecht K, Strangfeld A. Innere Medizin 2023; 64: 744-751; DOI: 10.1007/s00108-023-01484-3