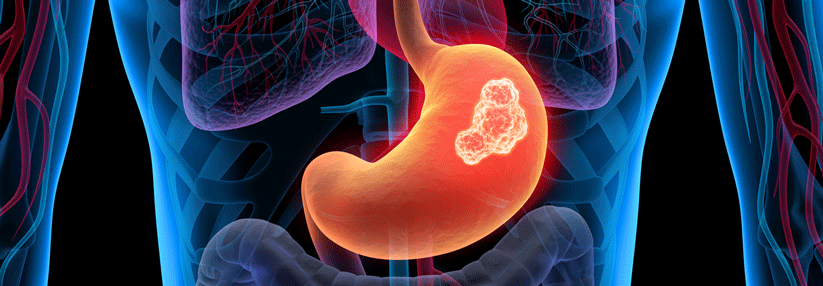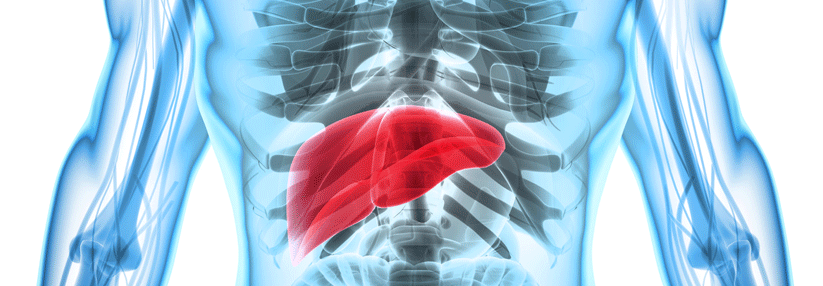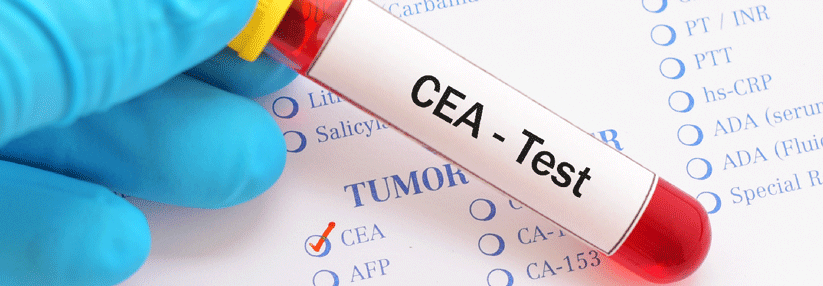Was bringt die gastroenterologische Krebsfrüherkennung?
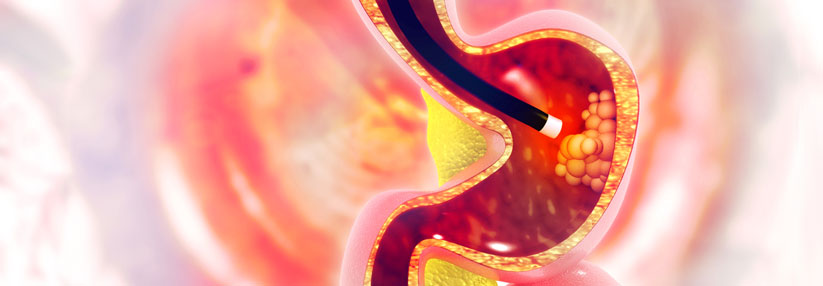 Etwa jeder zehnte Patient mit Magenkrebs hat eine positive Familienanamnese.
© iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen
Etwa jeder zehnte Patient mit Magenkrebs hat eine positive Familienanamnese.
© iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen
Die Antworten auf diese Fragen hängen vom jeweiligen Karzinom ab. Was das Barrett-Karzinom angeht, musste Professor Dr. Jürgen Pohl von der GastroClinic an der Asklepios Klinik Altona in Hamburg das Auditorium zunächst enttäuschen. „Screeningprogramme senken die Gesamtmortalität dieses Tumors nicht“, erklärte der Referent. Das große Problem: Man weiß nicht, wen man screenen soll. So haben z.B. mehr als 50 % der Patienten mit einem Barrett-Karzinom vorher keinen Reflux gehabt. Und nur bei jedem Zehnten waren vorher die vorausgehenden Schleimhautveränderungen vermerkt.
Für den Einzelnen kann sich die Endoskopie lohnen
Umgekehrt scheint sich allerdings die Überwachung bekannter Läsionen zu lohnen. Sie kann die individuelle Mortalität um bis zu 61 % senken. Die entsprechenden Studien weisen aber laut Prof. Pohl große methodische Mängel auf.
Das Risiko der Entartung steigt durch verschiedene Faktoren, aus denen ein Score entwickelt wurde (s. Kasten). Ein niedriger Wert rechtfertigt vermutlich keine jährliche Endoskopie, sagte der Kollege. Ansonsten rät die Leitline der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) zur Spiegelung ein Jahr nach Erstdiagnose eines Barrett-Segmentes, danach alle drei bis vier Jahre. Am besten verwendet man dafür ein Instrument mit Aufsatzkappe und evaluiert sowohl nativ als auch mit Farbe. Quadrantenbiopsien sollten alle 1–2 cm entnommen werden.
Der PiB*-Score zur Risikoabschätzung beim Barrett-Ösophagus
- männliches Geschlecht: 9 Punkte
- Länge des Barrettsegments: 1 Punkt pro cm
- Rauchen: 5 Punkte
- bestätigte Low-grade-Dysplasie: 11 Punkte
* Progression in Barrett’s Esophagus Score
Zu viele Leberkranke, um alle auf ein HCC zu untersuchen
Eine klare Steigerung des Überlebens bringt das Screening auf das hepatozelluläre Karzinom (HCC). Die Indikation dafür besteht bei einer Leberzirrhose jeglicher Ätiologie, chronischer Hepatitis B und der chronischen Hepatitis C mit Fibrose, erklärte Privatdozent Dr. Thomas Karlas, Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Universitätsklinikum Leipzig. Empfohlen wird es zudem Patienten mit nicht-alkoholischer Fettleberhepatitis (NASH) und Fibrose, schädlichem Alkoholkonsum und seltenen Erkrankungen wie der hereditären Hämochromatose. Primär dient dazu alle sechs Monate der einfach abdominelle Ultraschall, der Untersucher sollte Facharzt mit einer Erfahrung von mindestens 6000 Sonos sein. Das Ganze hat aber einen Haken: Bei alleine 800 000 Zirrhotikern, 1,6 Millionen NASH-Kranken und 400 000 Hepatitis-B-Infizierten fehlen in Deutschland die Ressourcen für die gewünschte Überwachung. Dr. Karlas sprach sich daher dafür aus, die Risikoklassifikation anzupassen und sich z.B. auf Hochrisikopatienten zu fokussieren. Das sind in erster Linie die mit Zirrhose. Bei ihnen bestimmen leberspezifische Endpunkte die Prognose, bei allen anderen haben extrahepatische Erkrankungen deutlich mehr Relevanz. Viel Positives wusste auch Professor Dr. Hana Algül, Klinik für Innere Medizin II, Klinikum rechts der Isar in München, nicht zu berichten. Sein Thema: das Pankreaskarzinom. Von Haus aus mit einer extrem schlechten Prognose behaftet – das 5-Jahres-Überleben beträgt selbst bei Entdeckung im Frühstadium nur 32 % –, tut sich leider in Bezug auf die Früherkennung wenig. Die altersadjustierte Inzidenzrate beträgt 15/100 000. Mit dem Screening von 100 000 asymptomatischen Menschen würde man aber rechnerisch auch 1000 Fälle entdecken, die sich als falsch positiv herausstellen würden. Das kommt also nicht infrage. Überträgt man die Kalkulation auf eine Hochrisikopopulation (familiäres Pankreas-Ca, muzinöse Pankreaszysten, Typ-2-Diabetes) mit einer Inzidenzrate von 150/100 000, lohnt es sich schon eher, hier wären etwa 100 falsch positive Fälle zu erwarten.Das Pankreaskarzinom bleibt ein hoffnungsloser Fall
Das sollte aber nur in hochspezialisierten Zentren stattfinden. Denn oft lassen die verfügbaren Screeningmethoden an Aussagekraft zu wünschen übrig und bedürfen des Blickes ausgewiesener Experten. „Die Bildgebung muss besser werden“, betonte Prof. Algül. Zuverlässige Biomarker existieren nicht und „sind noch nicht mal am Horizont erkennbar“. Dazu kommt, dass als einzige kurative Option nach der Entdeckung des Tumors die partielle Duodenopankreatektomie (Whipple-OP) zur Verfügung steht. Diese Operation hat aber eine Mortalität von mindestens 10 %, die postoperativen Komplikationsraten liegen zwischen 20 und 50 %. Guten Gewissens kann man dazu also nicht raten. Damit bleibt das Pankreas-Ca ein bislang hoffnungsloser Fall.Bei Magenkrebs in der Familie ggf. einen Gentest machen
Mit der Rarität des erblich bedingten Magenkarzinoms beschäftigte sich Privatdozent Dr. Jan Peveling-Oberhag von der Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Etwa jeder zehnte Patient mit Magenkrebs hat eine positive Familienanamnese, doch nur bei 1–3 % gibt es einen gesicherten Erbgang. Darunter dominiert das hereditär diffuse Magenkarzinom durch eine Mutation auf dem CDH-1-Gen. Betroffene Männer haben ein 70%iges Lebenszeitrisiko für den Tumor, bei Frauen beträgt es 56 %, dafür besteht bei ihnen noch ein 42%iges Risiko für ein lobuläres Mammakarzinom. Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Diagnose beträgt 40 Jahre und schon bei den jungen Patienten können bis zu 100 Herde gleichzeitig vorliegen. Da es sich um einen autosomal-dominanten Erbgang handelt, sollte man eine genetische Testung anbieten bei- mindestens zwei erst-/zweitgradig Verwandten, die an einem gastralen Krebs erkrankten (wenigstens einer davon diffus),
- einem Familienmitglied mit diffusem Magen-Ca vor dem 40. Lebensjahr,
- einem diffusen Magen-Ca plus einem lobulären Mamma-Ca plus einem Karzinom vor dem 50. Lebensjahr in der Familie.
Quelle: Viszeralmedizin 2019