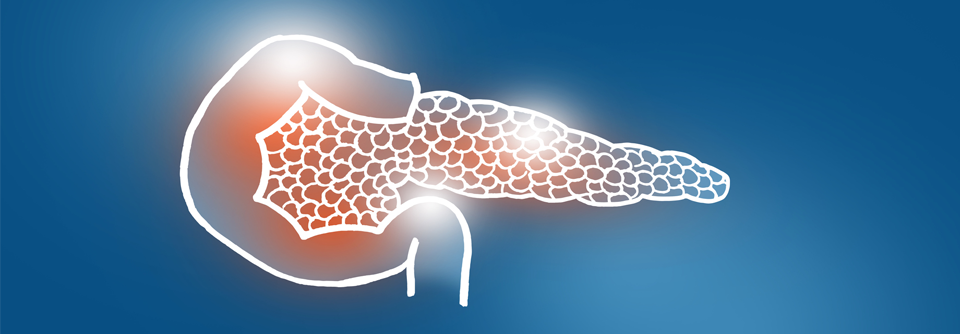Diagnostik Wenn die Zahninfektion zum Herzinfarkt wird
 Fehler, die von Kardiologen begangen werden, führen nicht selten vors Gericht.
© iStock/artisteer
Fehler, die von Kardiologen begangen werden, führen nicht selten vors Gericht.
© iStock/artisteer
Juristische Verfahren gegen Kardiologen werden nach einer US-amerikanischen Erhebung am häufigsten angestrengt wegen diagnostischer Irrtümer. Sie machen etwa 25 % aus. Es geht z.B. um inadäquate Differenzialdiagnostik oder das Ignorieren wesentlicher Befunde, berichtete Prof. Dr. Andreas Zirlik von der Klinischen Abteilung für Kardiologie der Medizinischen Universität Graz. Im Ranking folgen Fehler bei der technischen Durchführung einer Intervention.
Doch nicht jede Panne konnte eindeutig als Verletzung des medizinischen Standards gewertet werden und führt so auch nicht zu einer Verurteilung. Bei einem Fünftel der Verfahren stellte sich zudem heraus, dass der Patient selbst die Ursache für das Problem war, indem er z.B. bestimmte Anordnungen nicht befolgt hat.
Sowohl in der konservativen als auch in der interventionellen Kardiologie gilt, dass erfahrenen Ärzten weniger Fehler unterlaufen. Je häufiger z.B. an einem Zentrum eine Transkatheter-Aortenklappen-Implantation (TAVI) durchgeführt wird und je häufiger ein einzelner Arzt diesen Eingriff vornimmt, desto geringer ist die Quote an vermeidbaren Problemen.
In einer Befragung von leitenden Ärzten ermittelte Prof. Zirlik einige Probleme in der Diagnostik, die immer wieder auftreten. Eine Verdachtsdiagnose akutes Koronarsyndrom entpuppt sich manchmal als Aortendissektion, Myokarditis, Magenruptur, Subarachnoidalblutung (die häufig mit einem erhöhten Troponin einhergeht), Intoxikation oder gar als vertebragenes Schmerzsyndrom. Ein vermuteter Hinterwandinfarkt hat sich schon als Pankreatitis oder infizierter Zahn erwiesen.
In einer Studie zu diagnostischen Irrtumsraten führte die Aortendissektion mit knapp 30 %. Bei ihr besteht zudem ein besonders hohes Risiko für schwere Konsequenzen. Beim Myokardinfarkt liegt die diagnostische Fehlerquote zwar mit 2 % viel geringer, ebenso die Quote an schweren Konsequenzen für den Patienten, die sich aus einer Fehleinschätzung ergibt. Doch durch die viele höhere Fallzahl wird auch daraus ein relevantes Problem, so der Kardiologe.
Inkorrekter Verschluss führte zur Aortenembolie
Der Übergang von Komplikation zu Behandlungsfehler ist fließend, wie Prof. Zirlik anhand von einigen Beispielen aus seiner Abteilung verdeutlichte. Er berichtete von einem Patienten mit einem Vorhofseptumdefekt, den man mit einem Device verschloss. Das Device löste sich jedoch, weil es zu klein für den Defekt war, und es kam zu einer Embolisation bis in die Aorta ascendens.
Bei einem anderen Patienten wurde ein Verschluss der rechten Herzkranzarterie mit einem Stent versorgt. Dabei trat eine Reperfusionsarrhythmie mit Kammerflimmern auf. Der Patient musste kurz reanimiert werden, wobei der Katheter noch lag. Wenige Stunden später bekam der Mann wieder massive Beschwerden. Die rechte Kranzarterie war erneut verschlossen, hervorgerufen durch eine katheterinduzierte Dissektion. Möglicherweise wäre dies vermeidbar gewesen, wenn man nach der Reanimation noch eine Abschlussbildgebung gemacht hätte.
Ein anderer Patient erhielt eine TAVI mit selbstexpandierender Klappe, die zunächst gut implantiert erschien. Dann zeigte sie einen Pop-out nach oben, was auf einen zu hohen Sitz hinwies. Dieses Problem ließ sich durch eine zweite ballonexpandierende Prothese lösen.
Medikationsfehler ergeben sich manchmal dadurch, dass Präparatenamen sehr ähnlich klingen, Anordnungen können deshalb falsch verstanden werden. Auch ein häufigerer Fehler: Wegen eines Vorhofflimmerns bekommt ein Patient eine Antikoagulation, ohne zu berücksichtigen, dass dieser wegen seiner KHK schon seit Jahren ASS einnimmt.
In einem publizierten Fall ging ein Dosierungsfehler nicht gut aus für die Patientin, die eine Kardioversion bekommen sollte. Die Spritzen für die Sedierung waren bereits aufgezogen. Der Arzt ordnete dann an, dass sie verabreicht werden sollten, eine Kontrolle der Dosis fand aber nicht statt. So erhielt die Frau versehentlich die 15-fache Dosis von Fentanyl und eine fünffache Dosis von Midazolam, was sie nicht überlebte.
Um Fehler zu vermeiden, müssen standardisierte Qualitätsindikatoren gesetzt und auch gemessen sowie Dokumentationsstandards eingehalten werden. Zudem bedarf es einer strukturierten Kommunikation, betonte Prof. Zirlik. Dazu gehört, dass man individuelle Patientencharakteristika einschließlich Risikofaktoren erfasst und beachtet. Besonders relevant ist die Nierenfunktion, z.B. für die Dosierung von manchen NOAK oder für die Anwendung von Kontrastmitteln.
Klinische Pharmakologen mit auf die Visite nehmen
Es darf auch nicht passieren, dass der Interventionalist erst nach einer langen Prozedur realisiert, dass er einen Patienten mit einer GFR von 15 ml/min auf dem Tisch hat und damit eine kontrastmittel-induzierte Nephropathie riskiert. Es kratzt zudem nicht am eigenen Ego, wenn man gelegentlich einen klinischen Pharmakologen mit auf die Visite nimmt. Wechselwirkungen überblickt der Pharmakologe sicher besser.
Alle auftauchenden Probleme sind in regelmäßigen Teambesprechungen offen zu diskutieren und zu analysieren, damit alle daraus lernen können. Als Angriff auf die eigene Kompetenz darf dies keinesfalls verstanden werden. Und nicht zuletzt braucht es eine regelmäßige Fort- und Weiterbildung – auch für erfahrene Ärzte.
Quelle: 128. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin