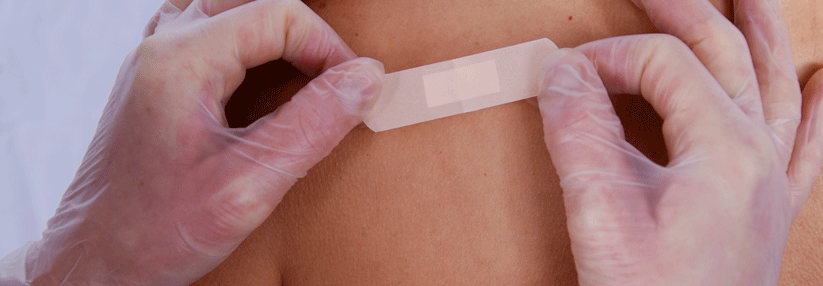Drug-Checking könnte auch in Deutschland Bewusstsein für Drogenkonsum schaffen
 Drei Viertel der „gecheckten“ Substanzen waren verunreinigt oder zu hoch dosiert.
© Couperfield – stock.adobe.com
Drei Viertel der „gecheckten“ Substanzen waren verunreinigt oder zu hoch dosiert.
© Couperfield – stock.adobe.com
Seit ihrem Besuch bei der Drogenarbeit Z6 in Innsbruck im Dezember vergangenen Jahres erwägt die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig (CSU), das dortige Drug-Checking auch in Deutschland umzusetzen. Zuvor stand sie dem eher kritisch gegenüber. Nun habe sie sich aber eines Besseren belehren lassen, sagt sie.
In einer Drug-Checking-Einrichtung können Menschen Proben von Drogen abgeben und auf ihre Inhaltsstoffe überprüfen lassen. So lässt sich feststellen, was in den Pillen und Pulvern tatsächlich enthalten ist. In Innsbruck wurden im vergangenen Jahr 513 Proben in Kooperation mit der Gerichtsmedizin getestet – knapp drei Viertel hiervon waren so verunreinigt oder hochdosiert, dass Warnungen vor dem Konsum ausgesprochen werden mussten.
Eingängige Beratung als Teil des Angebots
Die Verunreinigung durch Streckmittel ist zwar seit Jahren rückläufig, aber weiterhin der häufigste Grund, ganz bewusst vom Konsum abzuraten, berichtet Manuel Hochenegger, Koordinator des Innsbrucker Drug-Checking. Anders sei das bei einer hohen Dosierung, die unbewusst eingenommen hochriskant sein kann. Hier ließe sich die Gefahr durch eine geringere Einnahme reduzieren. Er macht aber auch klar: „Es ist nicht so, dass die Menschen zu uns kommen, die Proben auf den Tisch schmeißen und dann wieder gehen.“ Im Gegenteil: Die Beratung habe gerade beim Erstkontakt einen hohen Stellenwert. Dabei spielen psychosoziale Faktoren wie das persönliche Umfeld eine tragende Rolle; es gehören aber auch Substanzkunde und Tipps zur Schadensminimierung dazu.
Die Beratungsgespräche können auch mal eine Stunde dauern. Die Nutzer des Angebots vertrauen in die Expertise von Beratungsteam und der angeschlossenen Gerichtsmedizin. Die meisten seien Stammkunden, denen ein reflektierter und bewusster Konsum wichtig ist. Seit dem Angebot stehen viele von ihnen dem eigenen Konsum differenzierter gegenüber. Auch wenn alle Alters- und sozialen Schichten vertreten sind, besteht das Kernklientel aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Das Bestehen solcher Projekte soll auch die Öffentlichkeit auffordern, über Drogenkonsum nachzudenken. Hochenegger kritisiert: „Viele denken, wer illegale Substanzen nimmt, ist ein Junkie. Und wer statt einem Feierabendbier einen Joint raucht, ist für viele schon in der Gosse.“ Dieses veraltete Bild sei fernab der Realität und müsse dringend überdacht werden. Damit sei nicht gemeint, Drogenkonsum zu verharmlosen. Es ginge darum, für die Risiken des Substanzkonsums zu sensibilisieren und das Gesundheitsbewusstsein zu fördern. Und auch die Kritik, es ginge dabei um einen Freifahrtschein für Drogenkonsum, sei durch europäische Daten längst widerlegt. Drug-Checking gilt in den Ländern und Städten, die es ausführen, als beste schadensminimierende Maßnahme. Das hat sich durch Studien und Erfahrungsberichte bewiesen.
Durch das vertrauensvolle Verhältnis und die eingereichten Substanzen liegen den Drogenberatungsstellen zudem Daten vor, an die sie ohne das Angebot nicht herankämen. Daran ließen sich Markt- und Konsumtrends deutlich erkennen. In der Beratung kann darauf reagiert und neue Angebote geschaffen werden. Die Daten fließen außerdem in den europäischen Drogenbericht und eine gemeinsame Datenbank ein.
Partyhochburg Berlin hinkt hinterher
Dass es hierzulande bislang kein vergleichbares Angebot gibt, liege sowohl an der politischen Lage als auch am Markt selbst. Denn der Umgang mit neuen psychoaktiven Substanzen ist im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) nicht hinreichend geregelt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) blockierte bislang alle Versuche, Drug-Checking auch in Deutschland als Instrument der Suchthilfe zu etablieren. Dies kritisiert Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen) und pocht auf eine grundsätzliche Genehmigung.
Und selbst auf Landesebene hat die Entwicklung an Fahrt aufgenommen: Der hessische Sozialminister der Grünen Kai Klose verweist auf die guten Erfahrungen im europäischen Ausland. Er fordert die Möglichkeit einer Umsetzung im Rahmen von wissenschaftlich begleiteten Modellprojekten. „Es wird höchste Zeit, dass gerade in Städten wie Berlin, die sonst sehr fortschrittlich, pragmatisch und offen sind, auch Platz für dieses Angebot geschaffen wird“, findet Hochenegger. Dass es die Möglichkeit in einer verhältnismäßig kleinen Stadt wie Innsbruck seit sechs Jahren gibt, in einer der Partyhochburgen Europas aber nicht, ist in seinen Augen „extrem verwunderlich“.
Vom Land geförderte Präventionsmaßnahme
Auch in Innsbruck hat es von der Idee hin zur tatsächlichen Umsetzung im März 2014 mehrere Jahre gedauert, bis die Diskussionen mit Landesräten, der Polizei und der Staatsanwaltschaft erfolgreich ausgingen. Die Einrichtung wird vom österreichischen Gesundheitsministerium, der Stadt Innsbruck sowie dem Land Tirol gefördert, wobei Letzteres auch für die in der Gerichtsmedizin entstehenden Kosten aufkommt.
Zu Beginn bestand die Arbeit größtenteils darin, Vertrauen zu gewinnen. Doch mittlerweile scheint sich das Drug-Checking-Angebot zumindest in Innsbruck etabliert zu haben. Es gebe keine große Hemmschwelle mehr: Seit dem Start stiegen die jährlich eingereichten Proben von damals 71 auf 513 im vergangenen Jahr. Für Langzeitstudien ist es nach sechs Jahren noch zu früh. Da alles anonym abläuft, gestaltet sich eine Erhebung von möglichen Verhaltensänderungen ohnehin schwierig. Der Erfolg werde auf jeden Fall an den Rückmeldungen der Nutzer festgemacht, hebt Hochenegger hervor.
Für die Zukunft sind Impactstudies in Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern geplant, um diesen Erfolg statistisch zu bestätigen. Ob bis dahin auch Daniela Ludwigs Pläne in die Tat umgesetzt sind, bleibt abzuwarten.
Medical-Tribune-Recherche