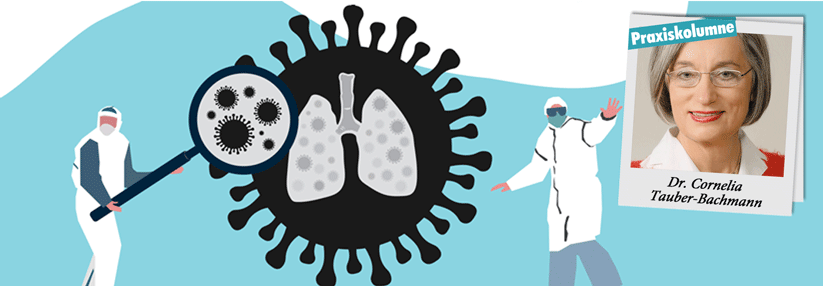Erst positiv denken, dann reden
 Ob gut oder schlecht gelaunt – es liegt in Ihren eigenen Händen.
© vegefox.com – stock.adobe.com; MT
Ob gut oder schlecht gelaunt – es liegt in Ihren eigenen Händen.
© vegefox.com – stock.adobe.com; MT
Ab und zu gibt es Patienten, die mag man. Die hat man regelrecht lieb. Zum Beispiel eine junge Frau, die mitten im größten Montagsstress lächelt. Man will es gar nicht glauben. Sie hat Gliederschmerzen, Fieber und alle sonstigen Infektzeichen und es müsste ihr eigentlich richtig schlecht gehen. Tut es auch. Aber sie schildert ihre Beschwerden trotzdem mit einem Lächeln. Und ich habe (wie davon angesteckt) sofort einen schönen Montag.
Dann dieser Typ, der aktiv Radsport betreibt. Immer etwas lauter und fröhlicher als andere, selbst wenn er mit seiner blockierten Brustwirbelsäule vor mir steht. Felsenfest davon überzeugt, dass ich ihm helfen werde und er schon bald wieder auf’s Rad kann.
Oder jene ältere Dame, Mitte achtzig, die man noch täglich in ihrem Garten sieht. Ihr Hauptproblem sind die wetterabhängigen Arthrosebeschwerden, wie bei so vielen ihrer Altersgenossinnen. Abhilfe gibt es kaum, aber sie nimmt es mit Gleichmut und freut sich an jedem Tag ihres Lebens.
Was hebt diese drei Beispiele ab von all den jammernden anderen Kranken? Sie denken positiv. Und sie haben zu tun.
Über die positiven Auswirkungen von sinnvoller Tätigkeit braucht man hier kein Wort zu verlieren. Die setzen wir ja auch therapeutisch ein, zum Beispiel um eine Trauerreaktion zu verkürzen oder als Ergotherapie bei den verschiedensten Diagnosen.
Aber ich gebe zu: Zum „positiven Denken“ hatte ich immer ein gespaltenes Verhältnis. Denn ich kenne jenen Vertretertypus, der von seinem Unternehmen mit aller Macht auf positiv getrimmt wurde. Dieses aufgesetzte Lautsein, das scheinbar rastlose Wuseln, der Abschluss-erheischende Blick ... Es hat mich stets abgeschreckt und skeptisch gemacht.
Diese oben beschriebenen Patienten dagegen haben mich zum Nachdenken gebracht. Denn wie jeder, der ein Unternehmen führt, ist man gut beraten, etwas Selbstreflexion nicht zu vergessen.
Übertrage ich nicht manchmal meinen Montagsstress auf einige Patienten, die ja gar nicht wissen können, dass ich heute schon eine Stunde eher angefangen habe, weil ich genau solche Massen hier erwartet habe? Ist es nicht so, dass ich oftmals kurz vor Mittag grillig werde, wenn viele Leute scheinbar erstmal ausschlafen mussten, um „in aller Ruhe krank zu werden“? Nervt nicht jener Kerl schon wieder mit der ellenlangen Liste seiner neu vermuteten Diagnosen (ich nenne es „Montagszettel“ oder „Google-Hupf“)?
Also las (und hörte) ich mich in die entsprechende Literatur ein. Eine Autorin riet zu einem interessanten Selbstexperiment: „Denken Sie an einem Tag mal komplett negativ und an einem anderen nur positiv!“
Negativ fiel mir nicht schwer, schon beim morgendlichen Blick auf den monatelangen „Dauerherbst“. Dann Inforadio im Auto mit den üblichen Corona-Schreckensmeldungen. Schließlich sah ich schon von draußen durch das Wartezimmerfenster all die aufgereihten Silberköpfe mit ihren „Montagszetteln“. Kurz: schlecht gelaunt klappte gut!
Am kommenden Montag dann ganz anders: War da nicht eine Wolkenlücke am grauen Morgenhimmel? Und hatte mir da nicht soeben die hübsche Nachbarin beim Losfahren zugeblinzelt? Im Autoradio gab es statt Inforadio heute ein Hörbuch von Dr. Murphy. Und ein gut gelauntes „Guten Morgen!“ in der Praxis.
Die Auswirkung beider Denkweisen war verblüffend. Am „negativen Montag“ zog sich die Sprechstunde in die Länge wie zäher Kaugummi, und ich war schon am Mittag total fertig und müde. Am Abend brauchte ich dann nur noch die Couch. Am „glücklichen Montag“ das genaue Gegenteil. Die Arbeit ging mir von der Hand, die ganze Praxis war ein breites Grinsen, trotz manchmal auch schwer Erkrankter. Und abends freute ich mich auf den Sport. Und danach auf Inspector Barnaby.
Seitdem versuche ich, jeden Tag zu einem glücklichen Tag zu machen. Dann kann mich selbst ein Patient namens Spahn nicht mehr erschüttern.