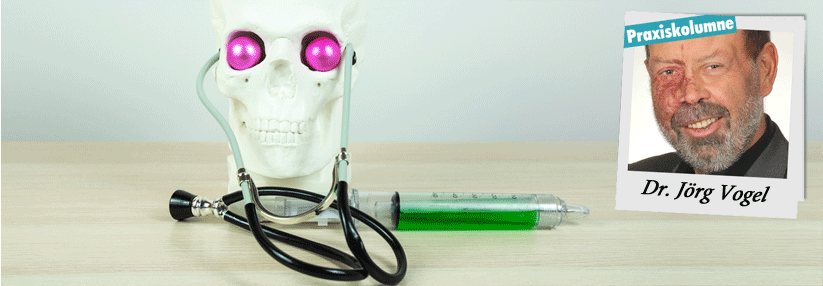Mein Lieblingsspiel: Stille Klinik-Post
 Raunendes Rätselraten: Fehlt der Entlassungsbericht, wird der Hausarzt zum Ermittler.
© iStock/Milkos; MT
Raunendes Rätselraten: Fehlt der Entlassungsbericht, wird der Hausarzt zum Ermittler.
© iStock/Milkos; MT
Wenn Patienten ins Krankenhaus müssen, dann ist das für sie ein einschneidendes Erlebnis. Falls eine OP ansteht, kann man das sogar wörtlich nehmen. Es ist eine Reise ins Ungewisse. Man begibt sich auf Gedeih und Verderb in die Hände von Leuten, die etwas mit einem machen, die in die Integrität des Körpers eingreifen. Und diese Leute sollten Profis auf ihrem Gebiet sein – zumindest hofft man das.
Inzwischen wissen viele auch, dass sie nicht in die „Sachsenklinik“ einchecken. Kaum ein Chefarzt hat noch Zeit, sich ans Patientenbett zu setzen, um die Krankheit durchzusprechen. Wenn aber überhaupt keiner mehr so richtig redet, dann befremdet das schon. Manchmal fällt als einziger zusammenhängender Satz: „Sie werden heute entlassen, wir brauchen das Bett.“ Erzählen jedenfalls die so Entlassenen.
Dann sitzt der Patient am nächsten Tag in meinem Sprechzimmer. Ohne jede Nachricht. Ohne jeden Brief. Mit drei bis fünf Tütchen in der Hand: in jedem eine Kapsel oder Tablette für den Folgetag. Auf meine Frage, wo denn der Entlassungsbericht sei, kommt die Antwort: „Der wird nachgeschickt.“ Oder: „Der war noch nicht fertig.“
Es gab auch schon chirurgische Patienten ohne jede Entlassungsmitteilung, die ich prästationär gar nicht gesehen hatte, weil sie von einem diensthabenden Arzt in tiefer Nacht als Notfall eingewiesen worden waren. Hier bleibt mir dann nur der Versuch, etwas aus der vorhandenen Wunde herauszulesen wie ein Fährtensucher in einem Wildwestfilm. Oder alles von dem Menschen, der vor mir liegt, zu erfragen.
Oft hat der aber gar nicht verstanden, was da akut an ihm herumoperiert wurde. Er war ja in Narkose. Und kaum aufgewacht, schon wieder draußen. „Blutige Entlassung“ nennt man das. So steht man als Hausarzt vor einem Bauchschnitt und spielt gemeinsam mit dem Patienten heiteres Diagnoseraten. Bei den Internisten klappt es etwas besser mit den Entlassungsberichten. Wahrscheinlich weil der Durchlauf langsamer ist als in der Chirurgie. Jedenfalls dachte ich das bis vergangene Woche.
Da saß dann tatsächlich jener 36-Jährige vor mir, den ich eine Woche zuvor mit Verdacht auf akutes Koronarsyndrom eingewiesen hatte. Ist das in dem Alter schon selten, so war es bei diesem sportlich aktiven, sich gesund ernährenden Menschen eigentlich kaum vorstellbar. Und doch entpuppte es sich als koronare Zweigefäßerkrankung und wurde mit zwei Stents versorgt.
Als der junge Mann dann ohne jeglichen Schriftsatz, dafür mit den üblichen drei Medikamententütchen vor mir saß, war ich sprachlos. Und falls unser ministerialer Oberhirte noch Klassenunterschiede in der Medizin sieht – dieser Mensch war Privatpatient! Nun weiß ich, unter was für einem Arbeits- und Zeitdruck die stationär tätigen Kollegen stehen. Und dass es permanent zu wenige sind, jedenfalls in unserem Großklinikum. Man hat den Eindruck einer Behandlungsfabrik, nur dem schnellen Durchlauf verpflichtet. Wo aber bleibt die Menschlichkeit? Wo die Kollegialität unter uns Ärzten?
Ich empfinde es als herabsetzend, wenn ich als Hausarzt einem Chirurgen nicht mal einen (von mir aus handgeschriebenen) Zettel wert bin, auf dem wenigstens das Notwendigste steht, z.B. „OP einer phlegmonösen Appendizitis am Tag X, Antibiose weiter bis zum Tag Y“. Zwei einfache Informationen, die mir zumindest die Weiterbehandlung erlauben.
Ich kann ja den frisch Operierten schlecht darum bitten, zurück auf Station zu latschen, um die Informationen zu besorgen. Genau das habe ich aber bei dem jungen Mann mit „gestenteter“ KHK getan. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, die Stationsärztin anzurufen, bot er an, selbst in die Klinik zu fahren, um dort den Bericht zu holen. Ich stimmte zu, riet ihm aber, gaaanz langsam zu fahren. Schließlich hatte er noch nicht mal seine Anschlussheilbehandlung erhalten.